
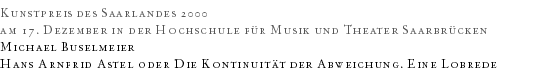
»Der Akzent ist die Seele der Rede« – diesen anfangs dunklen Satz, der von Lichtenberg, einem frühen Lehrmeister Astels, aber auch von ihm selbst stammen könnte, hat mir der hier zu Lobende kürzlich nach einer Lesung entgegengesprochen, als sublime Kritik an der von mir gerade vorgetragenen Prosa, die ihm vermutlich zu detaillistisch-beschreibend und zu wenig ins Kühne ausschweifend geraten war. »Der Akzent ist die Seele der Rede«, und wenn der Rede, dann doch wohl auch des Gesprächs und ganz besonders der Poesie. Der Akzent, spekuliere ich, ist die zündende Idee, der manieristische Einfall, der Augenblick der Überraschung, den ein plötzlicher Eingriff auslöst, der Blitz, der aus dem Gewölke kömmt, Signal einer Verwirrung stiftenden Revolte. Anders gesagt: Zwischen den akribischen Beschreibungen, die beispielsweise einen Prosatext konstituieren, sollten poetische Sätze oder abgründige Reflexionen, romantischer Witz und Wahn, Frühes und Vergessenes auch, Unvermutetes jedenfalls und genial Aphoristisches, die Ordnung Störendes aufscheinen, sonst ist alle Müh vergebens.
Seit ich Arnfrid Astel kenne, seit bald 40 Jahren also, ist dieses recht eigentlich romantische Moment der Plötzlichkeit und der Überraschung herausfordernd um ihn, Nähe und Ferne zugleich, ironisch funkelnde Produktivität, die einen zunächst verunsichert und dann bereichert, die aber auch sehr hochmütig wirken und sogar verletzen kann. Eine kindhaft selbstbezogene Aura, die mir als Haltung keineswegs fremd ist – bekanntlich wird man nicht nur als Kind zum Dichter, man bleibt auch als Dichter Kind – und die besagt: Sich möglichst nie festlegen lassen, auf keinen Termin, keine zusätzliche Verantwortung, keine eindeutige Äußerung, keinen kulturkritischen Jargon, keine Ideologie; vielmehr unberechenbar bleiben und unabhängig von allem, von Vorurteilen wie Familienbanden und anderen klammernden Kollektiven. Es ist nicht ganz einfach, jemanden zu begreifen, der sich ein paarmal im Jahr jugendlich beschwingt, wiegenden Schritts noch immer, in orangem Hemd und blauer Hose auf einem Feldweg nähert, dabei Dinge aufsammelnd, geheimnisvoll lächelnd, unalltäglich redend, um sich alsbald auf einem Waldweg wieder zu entfernen. Doch erstaunlicherweise können selbst solche punktuellen Begegnungen über die Jahre ein Gefühl von Kontinuität, Vertrautheit und Distanz einschließend, also Freundschaft begründen.
Zum ersten Mal habe ich Arnfrid Astel, der seit 1955 in Heidelberg Biologie und Germanistik studierte und seit 1959 die Zeitschrift Lyrische Hefte herausgab, im November 1961 gesehen, als er in der dortigen Volkshochschule eine Vortragsreihe zum Thema »Lesen und Erläutern zeitgenössischer Gedichte« mit Hans Magnus Enzensbergers frühen Bänden eröffnete. Schon damals sprach Astel frei und kommentierte, umgeben von seinem Lehrer und Meister Andreas Rasp und seinen jüngeren Freunden Jürgen Billich, Jörg Burkhard und Landfried Schröpfer, Enzensbergers für mich neue, ungewöhnliche Texte assoziativ. Er sprach ganz anders über Gedichte als meine Professoren, bescheidener und kühner zugleich, auf jeden Fall authentischer, weil er den Dichter nicht spielte, wie diese Herren es gelegentlich versuchten, sondern einer war. Doch ich war damals zu scheu, um mich ihm und dem Kreis um die Lyrischen Hefte zu nähern.
Unsere Freundschaft begann, wie so vieles, um 1968, ausgelöst durch jenes legendäre Kursbuch 15, in welchem Enzensberger, den Astel übrigens immer bewundert hat, der Schönen Literatur eine »wesentliche gesellschaftliche Funktion« aberkannte. Trotzdem standen – ein für diese bewegte Zeit typischer Widerspruch – im selben Heft acht politische Epigramme Astels und ein längerer anarchoider Prosatext von mir neben Prosa von Samuel Beckett und den letzten vier Gedichten Ingeborg Bachmanns. Seither haben wir beide eine Menge anspielungsreich abschweifender Gespräche geführt, die irgendwann doch meist ihr Ziel erreichten, an verschiedenen Orten, im Hörfunkstudio, bei Spaziergängen und Dichtertreffen, in Wohnungen und Autos, und er, mein »Blindenhund«, hat mich auf Erscheinungen gestoßen, die ich mit »unbewaffnetem Auge« nicht sah. Ich bekenne, viel von ihm gelernt zu haben, weniger in politischen Fragen, wohl aber, was Naturkunde, Mythologie und deren poetische Verknüpfungswege, überlieferte Bauformen der Lyrik und ihre listige Weiterentwicklung betrifft. In meinem Landroman Schoppe ist Arnfrid – unter dem Namen Hans – eine charismatische Hauptfigur, die dem staunenden Helden die Entwicklung der Meerschnecke aus der Muschel erklärt. »Die Schnecke / windet sich / aus der Muschel.« Seltsamerweise hat Astel trotz seinem pädagogischen Eros und seiner Ausstrahlung gerade auf junge Menschen nie »Schüler« im engeren Sinn gehabt, ich meine solche, die ihm nacheiferten, nachschrieben. Wahrscheinlich wollte er – anders als Stefan George – auch keine um sich haben. Und es scheint ihn nicht besonders zu freuen, wenn Werner Laubscher und ich gelegentlich in seiner Manier Haikus verfassen.
Der Lyriker Astel hat mit seinen bislang neun Gedichtbänden – darunter befindet sich einer, der annähernd 1000 Seiten umschließt – in den Spalten des tonangebenden Feuilletons, auch bei Groß-Schriftstellern und Gelehrten Akademien, nie die Anerkennung gefunden, die ihm eigentlich zusteht: weder in seiner aufgeregt politischen Phase, die grob gefaßt bis Ende der 70er Jahre reicht, noch weniger freilich in der anschließenden naturmythischen, in der es um ihn nur immer stiller wurde. Beide Perioden werden einander gern schroff gegenübergestellt, als hätten sie so gut wie nichts miteinander zu tun: Dort der antiautoritäre Protestlyriker, den man mit einer Mischung aus Neugier und Unbehagen, ja Abscheu betrachtet, und hier der etwas verschrobene Botaniker, mit dessen Kunststücken man erst recht nichts anzufangen weiß, schon gar nicht die linksliberalen Moralapostel; einige Betonköpfe belächeln ihn als abtrünnigen »Polit-Poeten«. Indes gibt einer wie Astel die Auseinandersetzung mit der besudelten Vaterwelt ja nicht zum Monatsende auf und wird unpolitisch, wie eine geistig überforderte und restlos angepaßte Kritik es sehen möchte. Vielmehr war und ist er – Beispiel Georg Büchner – stets beides zugleich, linksradikal und elitär, aggressiv und konservativ, Lautsprecher der Freiheit und auf dem Rückzug nach innen. Nur drängt sich, der gesellschaftlichen Wetterlage wie der eigenen widersprüchlichen Befindlichkeit folgend, mal die eine, mal die andere Seite nach vorn.
1968, als Astels erster Gedichtband Notstand herauskam, schienen Poesie und Politik, Dichtung und Revolution für einen Augenblick identisch zu sein, zusammenzufallen in der spontanen Aktion, im Sprechchor, im Eierwurf auf die »Charaktermasken«. Verse Astels standen auf Postkarten, Flugblättern, Wandzeitungen, wurden bei Teach-ins vorgetragen; einige haben die mitreißende Form des Aufschreis angenommen, etwa eines Zwischenrufs bei einer Wahlveranstaltung: »Heil Hitler / Hut ab / Kopf ab / Haut ab / Grüß Gott / Herr Kiesinger«. Es waren solche rasanten Auftritte, bei denen der Dichter vom Podium herab stellvertretend ›für alle‹ sprach, die Astels politisches Image in der linken Szene begründet haben – eine Szene, die zwar an Lyrik kaum interessiert war, sich aber vertraute Gedanken in Versform, am liebsten von Erich Fried, zur Bestätigung der eigenen Gruppen-Identität gnädig gefallen ließ. Auch der Dichter selbst, der keiner mehr sein wollte, wähnte sich endlich in der sogenannten Wirklichkeit angekommen und angenommen, sozial nützlich und nicht mehr so abgehoben und allein. Doch hat Astel nie Agitprop- oder Parteilyrik zusammengeleimt und nie zu etwas aufgerufen, sondern immer nur gegen das Herrschende und Tonangebende, die verlogene Sprache der Macht opponiert.
Astels an Martial geschulte Epigramme spielen mit dem Doppelsinn der Worte, sie laufen auf paradoxe Pointen hinaus, sie bauen auf Überraschung, Verstörung statt auf Bestätigung. Es gibt auch Kalauer darunter. Diejenigen, die sich bis heute gehalten haben, Hirn und Herz erhellende, Mut machende Gebilde, sind selten die ambitioniert politischen, die oft mit den Ereignissen untergegangen sind und leicht plakativ wirken, sondern eher solche, die den gesellschaftlichen Zwischenbereich der Erziehung, Bildung, Religion, Sexualität, auch den Literatur- und Medienbetrieb antithetisch mit listigen Fußnoten kommentieren: »Ich hatte schlechte Lehrer. / Das war eine gute Schule.« Oder, gegen bestimmte Germanisten gekehrt: »Ich habe Leute / über Hölderlin reden hören, die / mit ihm nicht / geredet hätten. / Mit denen will ich nicht reden.« Oft werden in Astels frühen Büchern, so in seinem zweiten Band Kläranlage (1970), sexuelle Tabus in einer Weise angegangen, die mich in meiner Prüdheit – oder ist es Scham? – noch beim Wiederlesen irritiert: »Gegen Morgen höre ich ein Geräusch wie beschleunigtes Atmen, / Ich denke, meine Frau masturbiert wieder. / Aber es ist der Nachbar beim Schneeschippen.«
Unleugbar gab es in diesen längst vergangenen Zeiten, als Erektion und Revolution sich spielerisch zu reimen schienen, bei uns allen, auch bei Astel gelegentlich, eine von heute her gesehen lächerliche Gewißheit, im Besitz der Wahrheit zu sein und fraglos auf der richtigen Seite zu kämpfen, während abseits Stehende die pure Verachtung traf: »Zwischen den Stühlen / sitzt der Liberale / auf seinem Sessel.« So lautet das heute in FDP-Kreisen mit Behagen und meist anonym zitierte Titelgedicht von Astels drittem Lyrikband, der neben neuen Epigrammen auch die Arbeitsgerichtsurteile »in Sachen Astel gegen den Saarländischen Rundfunk«, genauer: gegen dessen Intendanten Franz Mai, enthält und damit gewiß zur Verfestigung des politischen Images beitrug. Der genannte Dreizeiler war ursprünglich Ausdruck linken Hochmuts, mit dem wir auf die »scheißliberalen« Sesselhocker herabblickten, die sich für unsere Ziele nicht weiter mobilisieren ließen. Nun kommt es mir manchmal so vor, als hätte die Situation sich gespenstisch verwandelt, und wir selber säßen auf einmal auf diesen weichen Sesseln, »zwischen den Stühlen«, ratlos ergraut, und würden ab und an sogar mit Staatspreisen geehrt.
Es lebten in den fernen 70er Jahren auch Leute – Kritiker, Verfassungsschützer, der eigene Verleger –, die Astel »Tändeleien mit der Gewaltfrage« unterstellten, gar in ihm wie in Böll einen »Sympathisanten von Terroristen« zu erkennen glaubten, speziell eines irritierenden Dreizeilers wegen: »Selbstmord / durch Genickschuß / in Stammheim.« Sie reagierten auf dieses Kurzgedicht so hysterisch, als hätte der Verfasser, der nur die offizielle Verlautbarung zitiert, »Mord« statt »Selbstmord« geschrieben. In Wahrheit animiert er den Leser lediglich, die beiden real möglichen Varianten des noch immer ungeklärten Baader-Tods im Kopf durchzuspielen.
Grundsätzlich geht Astel ja, was damals kaum einer wahrhaben wollte, von der Reformfähigkeit der Gesellschaft aus. Er nennt darum seine Epigramme »Strafzettel / für den Rechtsstaat« und nutzt argumentierend die Lücke, die zwischen Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit offenkundig besteht. Er pfeift also nicht auf das Grundgesetz, wie so viele Linksradikale es taten, mit denen er in der Ablehnung des kapitalistischen Systems, der US-Politik oder der CDU/CSU übereinstimmte. Auch findet sich unter Astels zahlreichen Kurzgedichten kaum eines, das die SPD unversöhnlich attackiert oder Willy Brandt, der doch für die Berufsverbote mitverantwortlich war. Und erstaunlich ist, all seiner Spottlust zum Trotz, die Bereitschaft zur »solidarischen Mitarbeit«, wie das damals hieß, etwa im Personalrat des Saarländischen Rundfunks oder als ehrenamtlicher Arbeitsrichter, die Herausgabe der Lyrischen Hefte nebst Sonderheften bis 1971, die sozial-literarische Tätigkeit in der Jugendstrafanstalt Ottweiler mit Jochen Senf, die so gar nicht didaktischen Schreibseminare an der Universität Saarbrücken, vor allem die 30 Jahre währende Mittler- oder besser Hebammen-Rolle als Redakteur, wobei er Hunderten von Schriftstellern, darunter völlig unbekannte, die ihm das nicht immer gedankt haben, zu Lesungen, glanzvollen Werkstattgesprächen ohne jede Zensur und Honoraren verholfen hat. Und hat er nicht auch, wofür ich ihn manchmal getadelt habe, einen Teil seiner freien Zeit, die eigentlich dem Flanieren und Dichten dienen sollte, in so langweiligen und unproduktiven Einrichtungen wie im PEN-Präsidium oder gar im Vorstand des DKP-beherrschten Schriftstellerverbands zwischen all den toten Seelen zugebracht?
Ein weites Feld, das ich hier leider verlassen muß. Denn es bleibt noch ein weniges über den Naturlyriker zu sagen, den subtilen Jäger und Sammler, gar nicht so weit von Ernst Jünger entfernt, den »Torwart des Augenblicks«, der meines Erachtens Bedeutsameres – und sogar unerwartet Positives, klassisch Schönes! – zu Papier gebracht hat als der politische Epigrammatiker. Zwar hat Astel seit seinen Anfängen in den 50er Jahren und später neben den politisch inspirierten Arbeiten her fortwährend über Natur und Landschaft, Grabsteine und Tempelsäulen geschrieben. »Eine Kastanie / rollt mir vor die Füße. / Meine Schuhe glänzen.« So steht es 1968 in Notstand. Doch als Ende der 70er Jahre Poesie und Politik immer unversöhnbarer auseinanderklafften, Geist und Macht eigene Wege gingen, zog sich Astel aus dem mit Klischees zugestellten öffentlichen Baum, der wieder ganz den Funktionären gehörte, schrittweise zurück und verlegte die Revolte nach innen, in die Wahrnehmung und Deutung von Pflanzen, Tieren, Sternbildern, Steinen und anderen Fundstücken. Man kann auch sagen, er wandte sich den wesentlichen, bleibenden Dingen zu. Dadurch mag er manchen, die ihn zuvor zu verstehen meinten, unverständlich geworden sein.
Bereits in dem Band Die Faust meines Großvaters (1979) überwiegen Natur- und Liebesgedichte. Unter den verschiedenen lyrischen Formen, die Astel seither ausprobiert hat, finden sich neben zwei- und mehrzeiligen Epigrammen Verse im jambischen Metrum und solche mit Endreim, auch japanische Haikus und selbstkreierte Stutz-Haikus – »leuchtende Partikel«, so Wolfgang Hilbig, die beim Betrachten glückspendend changieren: »Zwei Brunnenfiguren / reden lebendiges Wasser.« Motivketten über Amsel und Grille, Muschel, Schnecke und Eidechse, Einhorn, Rose und Nachtigall laufen an. Zu Zyklen gruppiert, lassen sich solche Stücke hintereinander weglesen und erhellen sich wechselseitig. So entsteht von Einfall zu Einfall fast ein Naturepos aus Haikus oder ein »Entwicklungsroman aus Epigrammen« (Hubert Fichte), ein immer dichteres Geflecht jedenfalls, in Spiralform gewunden und tendenziell unabschließbar wie das Denken selbst. Große Teile von Astels Werk sind noch unveröffentlicht und müssen aus ihm wie die Grille aus ihrem Loch erst hervorgekitzelt werden; ein schwieriges Unterfangen. Nur wer reinen Herzens ist, bekommt ab und zu Bruchstücke aus der poetischen Geheimkorrespondenz Sand am Meer zugestellt.
Zunehmend begreift Astel sich als Natur- und Mythenforscher. Wer seinen Gedanken folgen will, sollte zumindest die Anthologia Graeca, Ovids Metamorphosen und Linnés lateinische Tier- und Pflanzenbenennungen kennen, um zu verstehen, wie sich etwa Daphne, von Apoll mit Vergewaltigung bedroht, in den glänzenden Lorbeerbaum verwandeln konnte, oder wie aus dem Blut des sterbenden Hyakinthos die Hyazinthe entstand. Man sollte auch metaphorische und emblematische Anspielungen schätzen und ein wenig mit der Etymologie vertraut sein, doch vor allem sollte man genau hinschauen: man befindet sich nämlich in einer Art ›Schule des Sehens‹. Dennoch wird vieles in fasziniernder Dunkelheit bleiben, während sich anderes unmittelbar offenbart: »Windenblüten / am Brunnenseil. / Die Augen trinken.« Auch der Schmetterling lädt zur Kontemplation ein: »Der Falter / entfaltet / sein schönes Geschlecht.« Geflügelter Phallus und Seelen- bzw. Totenfalter ineins, bedarf er des bürokratischen »Artenschutzes« nicht: »Retten willst du / den Schmetterling? / Laß dich retten von ihm! / Dann siehst du weiter.«
Todessymbole finden sich übrigens in den neueren Astel-Büchern reichlich, so auch in seinem meines Erachtens schönsten Band überhaupt, Jambe(n) & Schmetterling(e) oder Amor & Psyche von 1993. Todesboten wie die Amsel oder die Grille sind allgegenwärtig: »Geh ich vorüber, / verstummen die Zikaden. / Bin ich vorüber, / singen sie weiter. / Hör ich sie schaben, / muß ich verstummen. / Sterben die Sänger, / singe ich weiter. / Sterbe ich selber, / singen sie mich.« Die bewegendsten, weil persönlichsten dieser Gedichte sprechen, in immer neuen Anläufen, den Sohn Hans an, der sich 1985 erhängt hat und dessen Vornamen Arnfrid Astel seither trägt: »Schau ich dem Vogel nach, / schau ich nach dir.« Oder: »Wie Hühner trinken / hebe ich den Kopf, / daß mir die Tränen / ins Hirn zurücklaufen.« Oder: »Phantomschmerz, / mein Sohn tut mir weh, / mein abgeschlagenes Glied.« Und schließlich: »Es gibt dich / gar nicht mehr. / Aber ich rede mit dir / wie mit Gott.« Hier spricht ein Verlassener und Gezeichneter, um den man Angst haben muß.
Aber noch immer, wage ich zu behaupten, ist die Schrift, ist die Poesie das rettende Medium des Gedenkens. Seit alters faßt sie das Leid der Menschen (und, viel zu selten, auch das weit größere der Tiere) in symbolische Formen und hebt es so auf. Der von Schrotkugeln durchlöcherte Hase, der erschossene Große Bär und der von Artemis getötete Heroe Orion prangen verwandelt am Himmelszelt, der tote Hans hängt »am Polarstern« oder »im Sternenhaus«. Auch wir können unsere geliebten Toten an den Privathimmel bannen, zu ihnen sprechen und sie bei Gefahr als Nothelfer anrufen. Denn die lyrische Sprache ist das schroffste Gegenprogramm zum Bilderdreck der Medien wie zum Phrasengestrüpp der Politiker, und der Wortkünstler selbst, in Hans Arnfrid Astels Gestalt, ist der Andere und Eigene, lebenslang Abweichende, vom Tod Übersprungene, Übriggebliebene, der wissende Waldgänger und selbstironische Romantiker, der sich der Vorzeit annimmt und die Zeichen auf dem Zahn des Wals entziffert, in der Kontinuität des Widersprechens, der Macht stets gegenüber, vielleicht am aussichtslosen Rand, aber nicht korrumpierbar, die Kalmuswurzel in der Hand.
Copyright © 2000 Michael Buselmeier

Ich hab mir immer gedacht, wenn ich mal in die Verlegenheit kommen sollte, dann will ich auf keinen Fall etwas ablesen, aber ich bin zum Teil auch wieder davon abgekommen, ich werde nachher Gedichte ablesen, die kann ich mir nicht alle merken. Vorher will ich aber sagen, worüber ich nicht reden will. Ich will nicht darüber reden, wie glücklich ich darüber bin, daß dieser Preis in einer Hochschule für Musik und Theater verliehen wird, (Applaus) die zur Zeit in großen Kämpfen befindlich ist – die Plakate an der Wand verkünden es –, und ein Freund, nämlich Bert Lemmich, hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß die Abkürzung der Hochschule für Musik und Theater MUT bedeutet. Darüber möchte ich nicht reden. Worüber ich auch nicht reden möchte, ist die Schließung des Botanischen Gartens, die mir sehr leid tut. (Applaus) Worüber ich auch nicht reden möchte, ist, daß in einem von mir so geliebten Land, in dem es sympathischerweise oft mit der natürlichen Intelligenz hapert, daß dieses Land so sehr auf die Künstliche Intelligenz setzt. Darüber möchte ich auch nicht reden. (Applaus) Ich möchte auch nicht darüber sprechen, daß der von mir so verehrte Saarländische Rundfunk, in dem ich meine Lebensarbeitszeit verbracht habe – übrigens glücklich, also ein großes Wort, aber es hat mir gefallen eigentlich, und vor allem deshalb gefallen, weil ich mehr oder weniger machen konnte, was ich wollte, was mir allerdings nicht auf einem goldenen Tablett vorher gereicht worden ist, sondern… – aber darüber will ich alles nicht reden (Lachen), auch nicht darüber, daß der Saarländische Rundfunk sich bei allem Respekt, oder sagen wir besser bei aller Tötungshemmung gegenüber der Kultur zunehmend popularisiert, für einige meiner Freunde, was ich überhaupt nicht verstehen kann, bis zum Unerträglichen. Ja. (Applaus) Darüber will ich nicht reden.
Und jetzt kommt irgendetwas Heikles. Ich will auch nicht über den Traum reden, den ich heute Nacht hatte. Ja, wie soll ich das sagen? Ein Traum, Überschrift wäre: Des Kaisers neue Kleider. Und ich sah viele Freunde der CDU und vor allem der SPD, und sie kamen da, und da kam eine Kinderschar gerade aus einer Lesung von Harry Potter, (Lachen) und diese unbelehrbaren Kinder haben völlig respektlos gesagt, diese ganzen Politiker, deine Freunde, die haben ja gar nichts an, und da hab ich gesagt – alles im Traum – das stimmt nicht, kuckt mal genau hin, die haben doch ein Fußballertrikot an, (Lachen, Applaus) und auf dem Fußballertrikot steht CARITAS, (Lachen) und ich finde, man sollte es nicht überbewerten, daß sie natürlich, zu unser aller Erschrecken, die Hose heruntergelassen hatten, (Lachen) und da es meine Freunde waren von der CDU und von der SPD, habe ich dann gedacht, so kann man sie nicht rumlaufen lassen, (Lachen) und da habe ich meine eigene Hose ausgezogen, (Lachen) aber ich hatte ja nur eine an, ja, und die waren ne ganze Menge, und die haben dann sich zu helfen gewußt, wie Politiker sich eigentlich immer zu helfen wissen, sie haben nämlich meine Hose zu lauter kleinen Schamlappen verarbeitet, was man hochdeutsch auch Feigenblätter nennt, und dann bin ich aufgewacht und stand hier auf dem Podium. (Lachen, Applaus) Aber, wie gesagt, darüber möchte ich nicht sprechen.
Gedichtfolge mit Zwischenbemerkungen und Dank an alle Beteiligten:
CARPE DIEM (»Tunix«)
für Viktor Kurotschka
Angenommen, eine wichtige Arbeit wartet auf dich,
ohne daß du eigentlich sagen kannst,
auch du deinerseits wartest auf sie,
dann gehe ruhig wieder ins Bett nach dem Rasieren,
erhebe dich mittags für eine Pizza, ein Magenpflaster,
spaziere anschließend, bergsteige bis gegen vier,
schlafe wieder, ein, zwei Stündchen,
nachtmahle schließlich mit Wein oder viel Tee…
Jetzt bist du endlich frei,
einen großen Bogen um deinen Vorsatz zu machen.
Du wirst Erstaunliches zuwege bringen.
FRÜHLING
Wenn ich Specht sage,
geht eine Knospe auf.
Ein Knopf springt mir vom Latz,
wenn ich den Specht lachen höre.
Die Amsel zerrt
an meinen Schnürsenkeln.
KIESEL
Wie findest du den Stein?
Ich finde ihn naß.
Ich hebe ihn auf.
Er wird trocken.
Ich hebe ihn auf.
Er wird staubig.
Ich wasche ihn ab.
So finde ich den Stein.
EIN BLICK AUS DEINEM FENSTER
Die Türkentaube
pickt im Holunder.
Das hellere Grün
igeliger Früchte
in der Eßkastanie.
Äpfel vom Apfelbaum
vor den taubengrauen
Flügeln des Schieferdachs.
Bäume wachsen in den Himmel.
INS Freie mit dem Pfeil
dem Bogen ins Blaue
getroffen mitten
in die Luft den Bogen
gezogen zur Erde nieder
im Rasen zittert der Pfeil.
JEDER Wurf ins Wasser
ist ein Volltreffer.
Die Zielscheibe stellt sich ein.
MEIN persönlicher
Regenbogen.
Deiner daneben.
Wollen wir tauschen?
JEMANDEN LUSTIG FINDEN
Ich finde dich lustig,
das klingt wie:
ich mache dich lustig, so
als wärest du nicht lustig gewesen,
wenn ich dich nicht gefunden hätte.
ALGEN vom Stein
oder von der Aquarienwand
äsen die kleinen Fische.
Gedanken und – ja! –
Empfindungen
schnüffel ich dir
von Stirn und Schläfen.
OHNE GITARRE
Ich spiele mit meinen Fingern
die Saiten an deinem Puls.
Die Schnecke aus deiner Hand.
Das ist der leiseste Blues.
PORCELAINE
Ein Telefondraht
um die Taille
des Isolators, so
faß ich dir abends
fernmündlich
um die Hüfte.
ÜBER DIE FELDER
Wir gehen spazieren.
Du trägst dein summendes Kind.
Dein Schritt bestimmt
den Rhythmus des Summens.
Dein Fuß ist der Versfuß.
So lange der Atem hält,
so lang ist die Zeile.
So gehen wir Zeile für Zeile
über die Felder.
SPAZIERGANG
für Hans
Immer der Nase nach
gehe ich spazieren
immer meinen Gedanken
laufe ich nach
immer mit der Nase
in meinen Gedanken.
SPRECHSTUNDEN FÜR JAHRESZEITEN
Noch liegen die Zuschriften des Herbstes
unbeantwortet in der Schublade,
da schneit mir der Winter schon
mit neuen Briefen ins Haus.
Die Zettelkästen vom Frühjahr
bedürfen längst einer Revision,
und wenn es der Sommer bemerkt,
daß ich auf seine Gratulationen hin
einfach freundlich gehaltene
Danksagungen verschickt habe,
kann ich mich draußen nicht mehr sehen lassen.
Ich werde jetzt Sprechstunden
für Jahreszeiten einrichten
und alles mündlich erledigen.
NATÜRLICH habe ich Kopfschmerzen.
Aber das bin ich, der sie hat.
Und ich habe sie nicht nur vom Rauchen.
Daß da bald nichts mehr raucht,
das macht mir Kopfschmerzen.
Deshalb rauche ich.
RASEN verboten.
Betretenes Schweigen.
WER ist eigentlich dieser Achill,
fragte die Schildkröte
und fraß weiter an ihrem Salatblatt.
DAS Absurde Theater
gaukelt uns vor,
das Absurde
sei nur ein Theater.
SCHMETTERLINGE
Franz von Assisi predigte den Tieren.
Er lehrte sie mit seinem Zeigefinger
die Frömmigkeit der Menschen seinesgleichen,
wie Orpheus einst den Tieren vorgesungen.
Da flog ein Falter ihm auf seinen Finger.
So, meine Seele, sing ich von den Blüten,
ich rede zu den Menschen von den Tieren.
Als ich längst schweige, fliegt vor meinem Mund
dein Schmetterling auf meine Zungenspitze.
DIE Unschuld
trägt einen Ring
aus jüdischem Zahngold.
DER Halbmond
gießt aus der Tasse
seine Milch.
In die Nacht,
über dich und mich,
Berg und Tal.
Wir trinken
uns satt im Gehen,
im Augenschein.
Die Wärme
in der Schattenwelt
labt den Blick.
Zikaden
zirpen, Nachtgrillen
schlagen an.
Das Geläut
grasender Kühe
klingt von weit.
Hundsgebell.
Ein fernes Echo
bellt zurück.
Gerüche
führen die Nase
durch die Nacht.
Der Wind stillt
Zweige nach dem Sturm
im Ölbaum.
DAS macht nichts,
wenn du mich verläßt.
Ich geh mit.
EIN WÜRFELWURF IN DER EIFEL
Schwarz & weiß
sind die Lichtbilder
der Runde.
Fehlen wird
er, der noch da ist.
Wer da fehlt
auf dem Bild
ist der Fotograf.
Er lebt noch.
WÜRFEL ich Zucker
in dein Glas, süßer würdest
du. Ich verzückter.
DIE Dinge
sprechen mich an, stumm
wie Götter.
DER sardische Fuchs
beißt auf Granit. Das war kein
gesprenkeltes Ei.
NICHT Bote
die Bachstelze ist
die Göttin.
WANDERER, sei so gut
und geh weiter, der Tod
ist ein Schädel ohne Hirn,
er hat viele Gebeine,
aber er kann nicht laufen.