
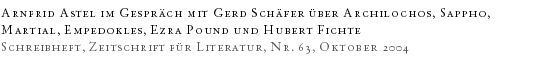
GS: Endlich sitzen wir beisammen, um über Hubert Fichte,
deine Freundschaft mit ihm und über die Alten zu reden,
über Griechen und Römer. Mit einer unvorsichtigen Höflichkeit
habe ich zugestimmt, dir die Eröffnung zu überlassen.
Es folgt nun, wie ich vermute, ein typisches Astel-Entree.
AA: Danke; höflich und unvorsichtig. Wir sitzen also hier, nach langen Planungen, in meiner Wohnung an einem kleinen Tisch, der üblicherweise ziemlich unaufgeräumt ist, weil Frühstückstassen und Abendbrotreste darauf liegen. Habe ihn extra für unser Gespräch freigemacht. Damit wir Platz haben; und damit du siehst, mit welch wunderbaren Keramikkacheln, die Mosaike vortäuschen, der Tisch belegt ist. Ursprünglich ist es ein Muster mit einem Wellenmotiv, einem Wellenfries, gedacht für Badezimmer. Ich habe sie jedoch als sogenannten »laufenden Hund« um das Viereck drapiert, so daß etwas Ähnliches wie ein Oktopus entsteht. Von einem »laufenden Hund« reden die Archäologen deshalb, weil die sich überschlagende Welle wie der geringelte Schwanz eines Hundes aussieht. – Lieber Gerd, nun ein zweites. Auf dem Tisch liegt außerdem eine Schale mit frischen Himbeeren. Und ich wollte das Gespräch in Umkehrung der sonst üblichen Art – du fragst ja mich, sprichst mit mir – selbst beginnen, weil mit der Eitelkeit des Schriftstellers immer zu rechnen ist; eben auch schon zu Beginn. Ich habe nämlich ein Gedicht über Himbeeren geschrieben, ist ein Weilchen her. Und das will ich dir jetzt vortragen.
GS: Aus dem Kopf?
AA: Natürlich aus dem Kopf, woraus denn sonst: »Gibt
es Himbeeren / auch im Himmel? / Der Himmel /
ist eine Beere. / Früher waren wir / selbst der
Himmel.« Das Gedicht heißt Morula, müßte
aber eigentlich Gastrula heißen. Beides bezeichnet
Zellstadien, nachdem sich die Eizelle vermehrt hat. Die Himbeere
sieht wie eine Gastrula aus, diese ist innen hohl, weil der Zellhaufen
sich eingestülpt hat. So!
GS: Hm, erst mal vielen Dank für diese eigenmächtige
und bemerkenswerte Eröffnung. Wobei ich gleichzeitig hoffe,
daß sich während unseres Gesprächs manches vergleichbar
entwickelt, möglichst ohne Hohlheit. Doch es zeigt sich
bereits jetzt, daß, wenn man dir gegenübersitzt, gelegentlich
der gelenkte Zufall, die gelenkte Vorsehung der Unterhaltung
ins Spiel kommt, kommen kann, und kommen soll. – Beispielsweise
ist in der Palette, dem wahrscheinlich bestverkauften
Roman Hubert Fichtes, der Oktopus, der Tintenfisch, eine zentrale
Metapher. Das Skelett des Tintenfisches wächst von außen
nach innen, von der Haut in den Körper. Und so ähnlich
verfährt Fichte beim Schreiben; das Offensichtliche wächst
als Gerüst in das entstehende Buch, es ist sein Kompositionsprinzip.
AA: So ist es sogar in der Embryonalentwicklung. Die Außenhaut
stülpt sich nach innen; und das ergibt dann die inneren
Teile des Körpers. Eigentlich ist das Innere ein Produkt
des Äußeren; wie beim Oktopus, wie in der Palette.
GS: Stimmt. Wie man sieht, gibt es die unterschiedlichsten Traumpfade
hin zu Fichte. Man könnte noch hinzufügen, daß
in der Palette die Tentakeln, die Fangarme, nicht zu unterschätzen
sind. Das Erzählen, Niederschreiben zieht nicht nur Wörter
und Worte heran, sondern gleichfalls den Leser selbst. –
Zu der wilden Einführung wäre noch zu sagen, daß
ihr beide, Fichte & Astel, einmal verwildert in Beziehung
gesetzt worden seid von einem gewissen Hans Peter Duerr, dem
bekannten widerspenstigen Ethnologen. In dessen Kampfblatt Unter
dem Pflaster liegt der Strand, einer Zeitschrift für
Kraut und Rüben, erschienen 1981 ausgewählte Epigramme
von dir, mit der Überschrift Verweilen der Wellen auf
dem Pflasterstein. In Fichtes Beitrag – es handelt sich
um die Polemik gegen Rimbaud, der, folgt man Fichte, in Afrika
als Ethnologe gescheitert ist – wird von Gelehrten »etwas
mehr Bücherwissen und Hinterfotzigkeit« gefordert.
AA: Noch mehr Bücherwissen? Die Hinterfotzigkeit leuchtet
mir direkt ein in bezug auf die Gelehrten, das könnte man
ihnen wirklich wünschen. Aber noch mehr Bücherwissen?
GS: Lassen wir es damit bewenden – und gehen jetzt verspätet
in medias res. Es gibt unter Eingeweihten ein legendäres
Schreibheft anläßlich des fünfzigsten
Geburtstages von Fichte, das vielleicht ein wenig zu kompakt
geraten ist. Man wünschte es sich offener, damit man die
Schätze besser entdecken kann. Beispielsweise wird bis heute
nicht wahrgenommen, daß damals die beiden Herausgeber,
Christoph Derschau und Norbert Wehr, sich ebenfalls die Mühe
gemacht haben, den ethnographischen, ethnologischen Fichte vorzustellen,
Auf der Suche nach einer poetischen Anthropologie. So
wurden verhältnismäßig unbekannte Artikel aus
einem eher randständigen Periodikum wiederabgedruckt, aus
der Zeitschrift für Ethnomedizin. Und es wurden außerdem
Kronzeugen Fichtes präsentiert; mit Lydia Cabrera eine Kubanerin,
die über Besessenheitskulte forschte, und mit Pierre Verger
der weltweit bekannte Ethnologe und Fotograf. Und es gibt im
Schreibheft von 1985 extraordinäre Recherchen, außergewöhnlich
besonders eine schriftliche Verwilderung, die im Titel den Namen
des ersten Lyrikers führt.
AA: Archilochos und das Verlangen, die Nachtigall anzulangen.
Ich kam durch Ed Sanders auf Archilochos. Sanders hat seine eigenen
Gedichte selbst gesungen, und es gibt von ihm ein langes Gedicht
oder Lied über Archilochos, worin es heißt: »Oh
I learned from Archilochos / about the nightingale /
oh I long to hold the nightingale / nesting in my hands«.
Sanders will also die Nachtigall berühren, »to touch
the nightingale«. Ich wollte eigentlich wissen, was damit
gemeint ist. Mein Verdacht war nämlich, daß schon
bei Archilochos das Geschlecht der Frau als Nachtigalljunges
bezeichnet wird. Dieser Sache bin ich umständlich nachgegangen.
Ich wollte ihr überhaupt nicht umständlich nachgehen,
war aber zur Umständlichkeit gezwungen durch die Prüderie
der Philologen, die überall sagen, wie derb und sinnlich
und sexuell Archilochos ist, dann aber relativ zahme Sachen zitieren.
Und die wilden, ungeheuerlichen Dinge, auf die ich neugierig
war und bin, einem vorenthalten. Die Recherche war sehr anstrengend.
Und jetzt kann man es sagen: Hubert war von Anfang an eingeweiht,
und es hat ihm gefallen. Über einen Mittelsmann erfuhr ich
dann aus Amerika, direkt von Ed Sanders selbst, die genaue –
versteckte – Textstelle. So war ich letztendlich durch eine
andere Umständlichkeit erfolgreich, und ich bin mittlerweile
sehr dankbar für diesen umständlichen Weg. Er war peripathetisch,
eigentlich Fichtes Methode.
GS: Wir reden hier über die Alten, über antike Autoren
in ihrer Beziehung zu Fichte, und sollten die Gelegenheit nutzen,
ebenfalls etwas über die Klassiker selbst zu sagen. Obgleich
man im Schreibheft eher anderes erwarten dürfte.
AA: Aber vielleicht ist gerade ein solches Verfahren modern:
Von der Gegenwart aus zu den Klassikern zurückzukehren.
GS: Dann versuchen wir es mal mit Archilochos. Wenn man die heute
zugänglichen Ausgaben aufschlägt, trifft man sehr oft
auf eine Empfehlung von Ezra Pound; übrigens für Fichte
das Maß aller Dinge, der Lehrer schlechthin. Für Pound
ist Archilochos der erste. Er hat nämlich etwas entdeckt,
erfunden: die Lyrik. – Ich will gleich etwas hinzufügen.
Merkwürdig bleibt, daß wir auf Archilochos hingewiesen
werden durch Amerikaner. Durch Ed Sanders beispielsweise, der
behauptet hat, er sei wegen Charles Olson zum Lyriker geworden.
Und Olson ist wiederum jemand, den Walter Höllerer in den
sechziger Jahren als Gastdozent ins Literarische Colloquium Berlin
einlud. In dem übrigens ebenfalls Fichte als junger Schriftsteller
war. Auf solch kuriose Korrespondenzen trifft man bei Hubert
Fichte immer wieder.
AA: Ja, das stimmt. Das Werk von Archilochos selbst ist sehr
dünn, Ed Sanders singt von »scattered lines«,
dafür ist der Kommentar ungleich ausführlicher, aber
nicht ausreichend. Ich persönlich bin nicht über Amerika
zu Archilochos gekommen, sondern durch mein Herumschnüffeln
in der Antike. Aber ich habe mich gefreut, als mir bewußt
wurde, daß die wilden Amerikaner eigentlich Altphilologen
waren, wie Sanders und Olson. Deren anderer Blick machte die
ganze Sache erneut interessant. Man kann Ezra Pound, den Urvater,
gar nicht hoch genug schätzen. Meine eigene Verschrobenheit,
im archaischen Archilochos herumzustochern, wurde durch Mitkämpfer
geadelt. Das Besondere an Archilochos ist seine direkte Gegenständlichkeit,
seine direkte Körper- und Dingbezogenheit, das heißt,
er faselt nicht moralisch und philosophisch in der Gegend rum,
sondern er ist eben darin archaisch, wie später Sappho,
daß er den Gegenstand, die Glieder des Körpers benennt,
wie auch die Liebe selbst. Und das alles nicht als eine Sprechblase,
sondern als etwas, das stattfinden kann; und was er stattfinden
läßt und woran er sich erinnert, daß es stattgefunden
hat. Aggressiv wurde er als Lyriker, wenn man ihm entgegentrat,
wenn Abmachungen gebrochen wurden. Schon in der Antike wurde
ihm der Vorwurf gemacht, die Gabe der Musen zu mißbrauchen;
eben weil er nicht immer schön ist, melodisch. Als Lyriker
ist Archilochos aggressiv; und das ist eigentlich gemeint, wenn
man von einem »Jambendichter« redet.
GS: Er war sogar Soldat.
AA: Ja. Er soll außerdem seine Feinde durch Schmähreden
in den Tod getrieben haben.
GS: Wenn man die »scattered lines« liest, kann man
durchaus zu der Meinung kommen, Archilochos sei ein ausgesprochener
Choleriker gewesen. Er ließ sich nichts gefallen. Bei ihm
geht es um persönlichen Ausdruck, wobei der Ausdruck immer
eine Stellungnahme ist. Es ist das augenblickliche Verhältnis
zur Welt, das erfaßt wird als penetrante Präsenz.
AA: Archilochos hat die Person in die Lyrik gebracht, er ist
derjenige, der »ich« sagt.
GS: Was es mit Jamben und Archilochos auf sich hat, konnte man
sehr schön sehen und hören, als du 1989 auf dem ersten
Fichte-Symposion deine schriftliche Annäherung mündlich
weiterführtest. Wobei du dem Jambendichter Archilochos alle
Ehre gemacht hast. Der Jambus wird oft als Metrum des Beschimpfens
verstanden.
AA: Ursprünglich war er das auch; diese Dichter wurden als
Jambographen bezeichnet. Was aber der späteren Entwicklung
entgegensteht; da verkommt der Jambus zum dahingeleierten Vers,
ist nicht mehr der Vers der Lyra. Er wird gezähmt.
GS: Aristoteles behauptete, daß Menschen im Alltag jambisch
reden.
AA: Das stimmt, der Rederhythmus ist alternierend, auf deutsch
betont / unbetont.
GS: Die alten Griechen beschimpften sich wahrscheinlich sehr
gern. Dein Vortrag führte dementsprechend dazu, daß
die Contenance im Publikum verlorenging. Die sehr akkurate Transkription
– zu lesen in der Sammlung Einhornjagd und Grillenfang,
die deine Zöglinge an der Universität des Saarlandes
herausgaben, du warst ja ein kleiner saarländischer Olson
– schließt mit einem merkwürdigen Tatbestand:
»Gegen Ende ist ein Tumult entstanden.« Dein wilder
Durchmarsch durch die Literaturgeschichte legte von den Anfängen
an, von Hesiod und dem Liebling Apollos mit Namen Archilochos,
sogenannte obszöne Etymologien offen, alles wurde von dir
auf das Geschlechtliche zurückgeführt. Was im Publikum
beinahe Schlägereien ausgelöst hätte, direkt hinter
mir.
AA: Na. Die damals ebenfalls anwesende Brigitte Kronauer ist
bis heute angetan von meinem unterhaltsamen Vortrag. Die Obszönität,
von der du sprichst, liegt in den Worten selbst; und in den Gegenständen.
Wenn also Archilochos in einer »scattered line« das
Geschlecht der Frau als Nachtigalljunges bezeichnet, ist das
zuallererst eine sehr zärtliche Beschreibung. Die Obszönität
ist ein Mißverständnis, das Benennen des Körpers
und der Liebe ist nicht obszön.
GS: Und wenn es um die alten Wörter geht, willst du sie
noch einmal mit Leben füllen.
AA: Ja, weil wir sie noch immer benutzen, aber leider harmonisiert
und entsexualisiert. Von Kindheit an werden sie uns ohne Verstand
lediglich eingepaukt, ad usum Delphini. Wir lernen keinen pädagogischen
Eros mehr kennen, Lehrer und Dozenten sind zu Steißtrommlern
degradiert.
GS: Fichte selbst, der als Schüler kein Griechisch gelernt
hatte, wurde mit zunehmendem Alter ein ausgesprochen fleißiger
Autodidakt. Wobei er im Buchstabensinn archaisch begann, er fing
mit dem Ursprung an, mit den Ursprüngen, mit Herodot und
Homer, dem ältesten Ethnographen und dem ältesten Epiker.
AA: Der älteste Lyriker ist Archilochos.
GS: In Fichtes Werk gibt es dann eine neue Tendenz, nämlich
die Zuflucht zu den alten Begriffen, wie logos, kosmos,
psyche.
AA: Wenn wir heute ein Wort wie Psychoanalyse benutzen, dann
sollten wir uns an die alten Bedeutungen erinnern.
GS: Es gibt noch ein anderes Wort, das bei Archilochos und Sappho
eine ganz andere Bedeutung hatte, nämlich das Wort »Koma«.
AA: Bewußtlosigkeit.
GS: Gemeint war einerseits Bewußtlosigkeit, andererseits
eine gewisse Übererregtheit, Überempfindlichkeit. Jemandem,
der besessen ist, stößt etwas Besonderes, nicht Alltägliches
zu.
AA: Koma wie Trance, sozusagen die Stufe der größten
Erregung.
GS: Du bist ein wahrer Stichwortgeber. Hier kommt wieder der
gelenkte Zufall ins Gespräch.
AA: Aber du weißt ja, daß ich über diesen Verdacht
erhaben bin. Ich bereite nichts vor. Die Geistesgegenwart –
das ist es; und nicht das Blättern in Büchern, das
haben wir früher gemacht, vor langer Zeit.
GS: Es gibt einen kleinen Text von Fichte, der in einem dicken
Buch erschienen ist, innerhalb der Geschichte der Empfindlichkeit,
in dem Glossenband Psyche. Enthalten sind unter anderem
Tagebuchaufzeichnungen aus dem Jahr 1985. Fichte hält sich
in Afrika auf, in Benin, und denkt über seine Rolle als
Beobachter nach. Es heißt, der »Zustand des Ethnographen«
ähnele der Trance, welche Gnade und Grazie heraufbeschwöre,
»zwei naturwissenschaftlich kaum zu reduzierende Begriffe«.
Überwachheit ist nach Fichte der eigentliche Zustand des
Ethnographen.
AA: Das ist das fokussierte Interesse. Diese Überwachheit
hatte Fichte in großem Ausmaß, wie auch Bruce Chatwin,
der in Australien die Traumpfade abgeschritten hat.
GS: Und übrigens Reisereportagen über Benin schrieb.
Fichtes und Chatwins Traumpfade haben sich mehrmals in Westafrika
gekreuzt.
AA: Diese Übererregtheit ist eine Übererregtheit erotischer
Art, es ist das Verlangen selbst. Giordano Bruno hätte es
»heroische Leidenschaft« genannt, es ist die Jagd
nach Erkenntnis. Man könnte es auch alttestamentarisch verstehen.
GS: Wie ich dich kenne, meinst du das Zusammentreffen von Göttlichem
und Menschlichem, lateinisch: Koitus, griechisch: Synagoge.
AA: Genau. Und dann kommen die Kinder, nicht nur das Wissen.
GS: Fichte rekurriert in dem Text auf einen anderen Begriff,
auf den Begriff der Epiphanie. Höllerer hat in den frühen
sechziger Jahren hierzu einen langen Essay geschrieben.
AA: Irgend etwas scheint auf und man nimmt es aufgrund der Erregtheit
wahr. Und will es dann schriftlich festhalten. Der Unterschied
zwischen der Antike und der Moderne besteht darin, daß
die Alten ihr Erregungsmoment göttlich apostrophierten.
Die Erregtheit kam von außen, Sapphos Zittern kam von außen.
Die moderne Versuchung, die agnostische, besteht darin, alles
physikalisch oder chemisch erklären zu wollen. Der Ursprung
liegt dann im Kaffeetrinken, und die Götter hausen im Kaffeefilter.
GS: Ethnologen reden von kosmologischem und psychologischem Code,
wobei die Begriffe mittlerweile selbst schon verhunzt sind. Die
Hinneigung zu Epiphanien birgt aber Gefahren in sich. Fichte
macht überall Epiphanien aus. Wenn er als Benin-Reisender
einen alten Mann sieht, ist sofort der »Sänger der
Ahnen des Königs« am Wirken: »Homer«.
Der vielleicht in »sapphischen Elfsilbern« singt
oder in »homerischen Versen«. Ein weiterer Sänger
lacht sein »kultisches Lachen«: »Archilochos
lacht. / Singt er einen falschen Ton, stirbt er am nächsten
Freitag.«
AA: Sehr gefährlich; Hubert neigte zu Übertreibungen.
Es gibt diese Manie, überall etwas zu sehen, was man sehen
will. Noch einmal zum Titel meines Beitrags, ich spreche vom
»Verlangen«. Verlangen will, daß das von außen
bestätigt wird, was innerlich erregt hat. Man will in das
Recht der eigenen Traumpfade eingesetzt werden. Eigentlich suchen
wir immer eine neue Bestätigung unserer selbst. Und die
Antike bietet dieser psychischen Vorstellung, dieser Sehnsucht,
dieser sentimentalischen Vorstellung sehr viele Gewährsstellen,
Gewährsleute. Die Antike wertet jemanden auf zu einer psychisch-somatischen
Person, die »ich« sagen kann. Okay, ich will nicht
verallgemeinern. Aber das Menschliche wäre genau das, die
heroische Leidenschaft – nach vorsokratischer Erkenntnis.
GS: Im Wortsinn ginge es dann um eine Anthropologie, die den
Ehrentitel des Humanen verdiente. Man beschäftigt sich ja
auch deshalb mit den Alten, weil gegenwärtig etwas fehlt.
Für Fichte hieß dies, Epiphanien nicht nur in der
Schrift festzuhalten, sondern sie, bei allen Gefahren, außerhalb
der Buchstaben zu suchen.
AA: Selbstverständlich, in den Dingen, in den Phänomenen.
Buchstäblich sind damit die Planeten als sichtbare Götter
gemeint, nur in ihren Namen waren die Götter erkennbar.
Und das sind die Erscheinungen. Was man mit den Augen sieht,
mit der Nase riecht, mit den Ohren hört, mit der Zunge schmeckt;
und was mit anderen Dingen des Körpers erfahrbar ist.
GS: Unser eigenartiger gelehrter Pfad führt jetzt vom Mann
zur Frau, von Archilochos zu Sappho.
AA: Sie lebte ein wenig später, nach Archilochos; von uns
aus gesehen ist sie jünger. Wir reden hier von einer vorchristlichen
Zeit. Und ihr Werk ist ähnlich dünn, »scattered
lines«.
GS: Fichte hat 1983 im Saarländischen Rundfunk seinen Sappho-Essay
selbst gelesen, einschließlich der griechischen Sappho-Stellen.
Genau fünfzehn Jahre nach der Palette-Lesung. Überraschend
ist aber, daß Fichte kurz darauf große Teile aus
einem Roman vortrug, der erst 1971 erscheinen sollte, nämlich
Detlevs Imitationen »Grünspan«; es gibt
sogar eine Saarbrücker Live-Lesung aus dem Jahr 1969. Man
findet erfreulicherweise im Archiv das mittlerweile bekannte
Kapitel über die Bombenangriffe auf Hamburg, berühmt
nicht zuletzt infolge W. G. Sebalds Nachforschungen zum
Schwerpunkt »Literatur und Luftkrieg«. Du hast Fichte
außerdem die Gelegenheit gegeben, seine Schriftstellerschelte,
die eigentlich eine Beschimpfung des Literaturbetriebs war, zum
Besten zu geben. – Detlevs Imitationen »Grünspan«
ist auch der erste Roman, in dem ein gewisser Wolli auftaucht.
Jäcki und Wolli führen gelehrte Gespräche. Und
Wolli beklagt sich darüber, daß er kaum dazu kommt,
»Pound und Proust« zu lesen. Worauf Jäcki erwidert,
er mache den ganzen Tag nichts anderes, er wünsche sich
mehr Geschlechtsverkehr. Hiermit ist wiederum der Bordellwirt
Wolli ausreichend versorgt. Die Gespräche der beiden sind
auch Versuche, Literatur noch einmal mit Leben zu füllen.
AA: Man könnte dialektisch sagen, Geschlechtsverkehr sei
nichts anderes als Verkehr mit dem Menschengeschlecht; Verkehr
hat nicht nur mit Ampeln zu tun. Die Jagd nach Erkenntnis ist
auch eine Jagd nach jemand anders, als Verlangen ist sie eine
sexuelle Jagd. Man forscht eigentlich, auch in der Literatur,
nach der Eigenart des Menschen. Wir wollen erfahren, was artig
ist, artig nicht verstanden in seiner verhunzten Bedeutung. Humanistisch
wäre die Bestimmung des Artgemäßen, dessen, was
dem Menschen gemäß ist. Deshalb sind dann die alten
Dichter und Philosophen interessant, sie waren auf genau diese
Fragen und Antworten scharf. Und Anthropologen, Ethnologen beschäftigen
sich letztlich mit dem Menschen. Aber leider ist der Begriff
heruntergekommen. Alle, von Merkel bis Schröder, reden davon,
daß im Mittelpunkt der Mensch stehe; aber sie wissen nicht,
was das überhaupt ist, der Mensch.
GS: Das ist wahrscheinlich die Triebkraft, die hinter jeder Ethnologie
und Literatur steht.
AA: Ich bin froh, daß du Triebkraft sagst. Der niedere
Trieb als höherer Trieb, das würde uns zur Psyche führen.
GS: In der Palette forscht Jäcki den Palettianern
nach. An einigen Stellen wird er gefragt, ob er Ȉ
la chasse« sei, auf der Jagd.
AA: Das sind elementare Zusammenhänge, von denen man in
der Volkshochschule und in der Universität nichts erfährt;
es hätte etwas zu tun mit der fröhlichen und triebbetonten
Wissenschaft.
GS: Vielleicht sollte man in einem kleinen Nebenpfad unseres
Gesprächs darauf hinweisen, daß nächstes Jahr
nach langer Zeit wieder ein Buch von Hubert Fichte erscheinen
wird, ein Text-Bild-Band gemeinsam mit Leonore Mau, der über
Geisteskranke in Afrika handelt; mit vertrautem Titel, Psyche.
Enthalten sein wird darin eine schon bekannte Veröffentlichung
Fichtes mit dem programmatischen Titel Die Buchstaben der
Psyche. – 1978 steht jemand, wahrscheinlich Fichte selbst,
in Togo, in Lomé, auf einem Zaubermarkt und hält
ausliegende Gegenstände und sich einstellende Gedanken fest.
Eingestreut sind Zitate von Lohenstein, Novalis, Empedokles und
Bobrowski. Die Meditation endet mit folgenden Worten: »Die
Dinge haben Macht über mich, weil ich sie selbst einmal
war. / Buchstaben. / Stäbe, die auf den Boden
geworfen werden? / Die Buchstaben der Psyche.« Man
muß das immer wieder herausstellen. Auch wenn Fichte ein
welthaltiger Schriftsteller war, bei ihm ging es vor allem um
Literatur, um das Buchstäbliche. Und, aus eigener Kraft,
aus eigenem Vermögen etwas darzustellen, noch einmal das
darzustellen, was die Alten hinter Begriffen versteckten.
AA: Was sich sehr gut in seinen Sappho-Studien zeigt. Warum beschäftigt man sich mit den alten Griechen? Ganz einfach: weil sie interessant sind. Jeder, dem etwas an Literatur liegt, landet irgendwann bei Sappho.
GS: Es ist aber schon merkwürdig, wenn man sieht, was aus
den Bewegten der sechziger Jahre geworden ist. Sie werden mit
der Zeit, man kann dies positiv sehen, reaktionäre Literaten.
AA: Richtig. Aber immer noch zu wenig. Ich hing dem nicht an,
als im Kursbuch der Tod der Literatur verkündet wurde,
Hubert erst recht nicht. Was aber nicht so wichtig war. Ich will
es paradox ausdrücken. Eigentlich geht es mir gar nicht
um Literatur; sondern um das, was unabhängig von der Literatur
existiert. Und dann um den Transfer, um Metamorphosen. Hubert
war, man vergißt das, auch ein Ethnobotaniker. Daß
Dinge ihren lapidaren Begriff erhalten, was selten geschieht,
ist die erste Aufgabe des Schriftstellers. Vor der Literatur
liegen die Gegenstände.
GS: Bei Fichte und auch bei dir kann man immer den pädagogischen
Eros am Wirken sehen; und ihr befindet euch deshalb in ehrenwerter
Nachfolge von Ezra Pound, dem großen Lehrmeister der modernen
Literatur. Fichte hat einige Maßstäbe von ihm entliehen.
Neueren Sappho-Editionen ist sehr oft ein Pound-Zitat vorangestellt:
»Willst du den Inbegriff der Sache, geh zu Sappho.«
Es ist sogar das Motto der Sappho-Übersetzung von Joachim
Schickel, der eigentlich bekannt wurde als Mao-Eindeutscher.
AA: Ich kenne diese Übersetzung, habe sie gesendet im Saarländischen
Rundfunk. Es war eine Ursache für meinen Konflikt mit dem
damaligen Intendanten, dessen Name mir gerade entfallen ist.
GS: Fichte bezieht sich gegen Ende seines Essays ebenfalls auf
Schickel, der, wenn man ihm glaubt, mehrere Jahrzehnte an der
Übersetzung gearbeitet hat. Es handelt sich bei Sappho um
hundert Originalseiten. Wobei die Passagen selbst lediglich durch
Gewährsleute überliefert sind. Beispielsweise durch
einen gewissen Maximus von Tyros; und genau von diesem Mann leitet
sich der Titel der Maximus Poems von Charles Olson ab,
einer Gedichtsammlung, die den Cantos von Ezra Pound gleichgestellt
wird. Olson hat schon sehr früh, nach dem Zweiten Weltkrieg,
lyrische Huldigungen auf Sappho geschrieben, wie auch der nicht
hoch genug zu schätzende William Carlos Williams. Williams
kommt hierbei auf etwas Besonderes zu sprechen, »skill
in composition« nennt er es, die Fertigkeit im Aufbau von
Lyrik. In dieser Zeit ist Fichte aufgewachsen, in dieser Zeit
wurde er zum Schriftsteller. Schickel war, nebenbei bemerkt,
Redakteur beim NWDR, dem Vorläufer des NDR, als Fichte zum
jugendlichen Radiosprecher ausgebildet wurde. Es ist ein Übermaß
von Traumpfaden, mit denen sich ein nachgeborener Spurenleser
abzumühen hat.
AA: Das sind die Beziehungen, die zählen. Wie auch die Beziehung
zwischen Olson und Rainer Maria Gerhardt, dem ersten deutschen
Pound-Übersetzer. Und dann das Interesse von Helmut Salzinger
an Gerhardt und an den Amerikanern, an der Literatur Chinas und
Japans. Wodurch dann eine ideogrammatische Literatur quasi entdeckt
wurde; der beobachtete Gegenstand soll durch Buchstaben buchstäblich
evoziert werden, als Gedankenbild.
GS: Salzinger hat übrigens Fichtes Palette besprochen.
Und in Detlevs Imitationen »Grünspan«
gibt es lange Ausführungen zum Ideogramm.
AA: Ich denke aber, daß es nicht nur literarische Traditionen
sind. Durch literarische Spuren wird eine menschliche Spur festgehalten.
Und diese menschliche Spur gibt es natürlich in allen Zeiten.
Die Literatur bewahrt, wenn sie gelingt, manchmal auch wenn sie
mißlingt, eine anthropologische Konstante. Man sollte sich
um Kultur- oder Geistesgeschichte nicht um ihrer selbst willen
kümmern, sie sind eher Beweise dafür, daß Menschliches,
Menschen schon vorher da waren. Und diese großen Denker,
Archilochos und Sappho, sind Gewährsleute für das,
was wir als Spätlinge auch wollen. Es geht dabei nicht nur
um den Menschen selbst, sondern auch um den menschlichen Ausdruck.
Hubert war auch – und das sollte man nicht vergessen –
ein Botaniker, dem es um eine genaue Benennung ging, um eine
zielgenaue Sprache, um Taxonomie.
GS: Als Schriftsteller jedoch hat er, so Fichte, von Sappho gelernt,
»was eine Zeile ist«. Das ist allerdings kein Satz
eines Botanikers, sondern das Geständnis eines Schriftstellers.
AA: Ja, hm, ja. Man kann aber von Sappho ebenfalls mit Gewinn
verlernen, was eine Zeile ist. Da ist viel dran, aber auch viel
nicht dran. Wir reden hier von poetischen Traditionen, die wir
alle nicht genau kennen. Wir wissen nicht, wie Lyrik damals gesprochen
wurde. Wie die Prosodie wirklich war, die Melodik, die Musikbegleitung.
Und kann ein Prosaschriftsteller wirklich etwas von Lyrikern
lernen …
GS: Man könnte sich einiges vorstellen als Begleitung für
soch einen Vers: »Gliederlösender Eros treibt mich /
um, süß-bitter, unzähmbar, ein wildes Tier.«
AA: Richtig, könnte man. Aber ich muß jetzt als Jambograph
ein wenig aggressiv gegen dich werden. Und gegen dein Curriculum,
deinen sorgfältig geplanten Gesprächsverlauf. Weil
ich noch immer einem Gedanken nachhänge. Wo hat eigentlich
Sappho gelernt, was eine Zeile ist? Wir Spätgeborene können
leicht Stammbäume aufstellen, wir haben die Versgeschichte
in Büchern niedergeschrieben. Natürlich gibt es Traditionen.
Auch Sappho ist nicht auf der flachen Hand gewachsen. Nur kennen
wir kaum ihre Zeitgenossen. Aber was ich sagen will: Von Sappho
eine Zeile lernen – wunderbar; weil Sappho ihre Zeile von
sich, ihrer Liebe, ihrem Körper und von den Phänomenen,
der Wahrnehmung der Dinge gelernt hat. Das heißt, was vor
der Literatur ist; nicht historisch gesehen. Bevor ich ein Gedicht
schreibe, bin ich ergriffen, bin ich ins Zittern gekommen. Man
kommt nicht beim Gedichteschreiben ins Zittern. Ich behaupte,
Sappho hat mindestens zur Hälfte gelernt, was eine Zeile
ist, mittels ihrer Vorstellung menschlichen Verkehrs und durch
ihre Praxis; das übrige war Tradition, Poetologie und bereits
damals bekannte Literaturgeschichte. Als Person war Sappho eine
Lehrerin für junge Mädchen, die sie ausbilden und heiratsfähig
machen sollte, sie vermittelte sie durch Bildung, Gesang und
Tanz an Männer. Sie machte Mädchen begehrenswert; und
vielleicht hat sich Sappho dann in die eigenen gelungenen Bildungsergebnisse
verliebt.
GS: Man könnte einen Begriff benutzen, der mittlerweile
anders gebraucht wird. Sappho löste duch Bildung bei Mädchen
ein »coming out« aus. Die Mädchen sollten zu
sich selbst finden. Und wurden dann verheiratet.
AA: So wie man einen Schmetterling – griechisch: psyche
– in der Hand behaucht, damit er wieder ins Leben und zum
Flug kommt, so hat Sappho die Koren, die jungen Mädchen,
les jeunes filles en fleurs, behaucht, sie hat sie eigentlich
durch Bildung belebt.
GS: Da sprach jetzt der Naturdichter. Auch in Fichtes Werk gibt
es die Tendenz, geradezu die Manie, Menschen zu sich selbst finden
zu lassen; immer jedoch gemäß Fichtes eigenem Verständnis.
Zwanghaft wird etwas offengelegt. Typisch ist hierfür ebenfalls
der Sappho-Essay, der durch ein Übermaß an zur Schau
getragener Bildung gekennzeichnet ist.
AA: Aber gleichzeitig bildungsverachtend ist; oder die Gebildeten
verachtend.
GS: An einigen Stellen zeigt er Witz im alten Sinn, beispielsweise
im Titel: Männerlust – Frauenlob. Anmerkungen zur
Sapphorezeption und zum Orgasmusproblem.
AA: Den hat Hubert bewußt gewählt. Er war und ist
notwendig wegen der Prüderie, nach den Editionen ad usum
Delphini und in Zeiten von Beate Uhse. Sappho selbst wäre
ein Wort wie »Orgasmusproblem« nie über die
Lippen gekommen.
GS: Fichte hat sich immer gegen Projekte ad usum Delphini gewandt,
gegen, wenn die Wortkeckheit gestattet ist, Flipper-Bücher
aus dem Kinderprogramm.
AA: Stimmt. Wenn diese Unternehmungen sich wenigstens auf dem
Niveau des Delphins tummeln würden. Vom Delphin kommt man
sehr schnell nach Delphi, was meine kecke wörtliche Entgegnung
ist. Und dann wäre man buchstäblich nicht mehr weit
weg vom griechischen Ausdruck für Gebärmutter. Dies
nur als Nachtrag zu den vermeintlichen Obszönitäten.
GS: Obszön meint ursprünglich das, was der Szene entgegensteht;
was nicht dargestellt wird, nicht dargestellt werden darf.
AA: Das ist eine ganz wichtige Sache. Die Literatur, die Dichtung
spricht das aus, was eigentlich nicht gesagt werden darf und
nicht gesagt werden kann. Aus diesem Paar, unsagbar –
unbeschreiblich, entsteht die Kunst.
GS: Weil man weiß, daß es geschieht. Wie man es beispielhaft
im Ödipus erfahren kann. Gezeigt wird nicht, wie
Ödipus mit seiner Mutter schläft und wie er sich blendet,
sich die Augen aussticht. Das ereignet sich im Obszönen;
geredet wird darüber auf der Bühne.
AA: Das macht auch den Unterschied zwischen Tragödie und
Lyrik aus.
GS: Man kann darüber reden, schreiben, man kann es ausdrücken,
wenn man es kann.
AA: Und wenn man den Mut dazu hat. Das Verbot zu überschreiten
im Unvermögen, führt selbstverständlich zu großen
Peinlichkeiten.
GS: D'accord. Die plumpe Frechheit reicht nicht aus.
AA: Gefragt ist die Literatur techne, poiesis.
GS: Genau darauf richtet Fichte im Sappho-Essay sein Hauptaugenmerk.
Er zitiert Benn, der ein Gedicht als »einfach und raffiniert«
bezeichnete; und Fichte geht dann bei Sappho dem »Raffinement«
nach. Man kann ein solches Vorgehen aber als heikel empfinden.
Wir sind schon lange keine Griechen mehr; die Deutschen dachten
einmal, sie wären Griechen.
AA: Die Griechen waren doch selbst keine Griechen, eigentlich
waren sie Barbaren, Griechen nur für eine kurze, sehr kurze
Zeit. Und auch sie konnten es – die Literatur konnte es
– nur in günstigen Augenblicken. Literatur gelingt
nur ganz selten, die Gesamtausgaben beweisen es, sie enthalten
eine Unzahl an gescheiterten Versuchen. Wir sollten den Philologen
– beispielsweise Petrarca, der nicht nur Poet, sondern auch
Philologe war – dankbar sein, daß sie uns das Gelungene
überliefert haben.
GS: Zur Not genügen eben »scattered lines«,
wie bei Archilochos und Sappho. Das Besondere, was Fichte bei
Sappho ausmacht, ist das »konkrete Sprechen«. Fichte
bezieht sich hier vor allem auf den griechischen Begriff der
»Pathographie«.
AA: Der Niederschlag von Leidenschaft in Sprache – das wäre
Pathographie; Leidenschaft, die zu Buche schlägt. Und wir
Zeitgenossen drehen uns zu den Alten um, damit wir sehen, was
ein Mensch der Zukunft sein könnte. Es gab eine Zeit, in
der alles ausgesprochen werden konnte; auch die Sinnlichkeit.
Wir versuchen es noch einmal, mag es gelingen oder mißlingen.
GS: Im Jahr 1983 gibt es exquisite Koinzidenzen, also im Jahr,
in dem der Saarländische Rundfunk Fichtes Sappho-Essay sendet.
AA: Das stimmt, sei aber bitte vorsichtig. Ich war nicht der
SR, der SR war nicht Astel. Huberts letzte Arbeiten waren Zumutungen
im besten Sinn. Ich mußte sie eigensinnig im Radio durchsetzen.
GS: Als Nachgeborener ist man dankbar, die Bänder liegen
wohlbehütet im Archiv.
AA: Das sind wahre Schätze; und wir sollten einen gewissen
Bert Lemmich grüßen, der uns bei unserem Gespräch
sehr geholfen hat; als verantwortungsbewußter Archivar.
GS: Und der – das will ich nicht verschweigen – als
neugieriger Mensch das Sappho-Band anhörte, um festzustellen,
daß er beim ersten Hören kaum etwas verstand. Er mußte
das beiliegende Manuskript durchlesen, um der Überfülle
an Bildung, an Information einigermaßen Herr zu werden.
Besonders gefielen ihm, auch bei anderen Fichte-Sendungen, die
kleinen Beigaben, nämlich die Briefe von Fichte an Astel
und umgekehrt.
AA: Könnten interessant sein. Aber gerade bei Hubert habe
ich mich stets geweigert, nur das zu senden, was ich auf Anhieb
verstanden habe. Zumutungen sind doch deshalb notwendig, weil
durch sie Interesse geweckt wird, geweckt werden kann. Es macht
keinen Sinn, die eigene Unwissenheit, die eigene Beschränktheit
zum Maßstab zu nehmen.
GS: Es wäre bedauerlich, wenn schon die erste Begegnung
mit Literatur das Ende wäre. Man braucht zuallererst Anregungen,
man muß anfangen, etwas zu ahnen.
AA: Und dann selber mehr wollen. Hubert konnte neugierig machen.
Später begegnete mir ein ähnliches Phänomen bei
Raoul Schrott, im Buch Die Erfindung der Poesie.
GS: Mag Schrott auch ein Windhund sein, für ihn spricht,
daß in der Erfindung der Poesie Archilochos und
Sappho vorkommen.
AA: Ich bestehe darauf gegen dich, mein Freund, daß Raoul
Schrott kein Windhund ist. Wäre er ein Windhund, hätte
er kleine Flügel.
GS: Na ja. Zurück ins Jahr 1983. Und zu dem sogenannten
neuen Martial, wie Fichte einen gewissen Arnfrid Astel
genannt hat. Seinen gleichlautenden Essay schrieb er 1983 nach
einem großen Luther-Aufsatz und vor der Sappho-Untersuchung.
Du bist eigentlich zwischen Bibel-Übersetzung ins Neuhochdeutsche
und griechischsprachiger Pathographie zu beheimaten. Es ist übrigens
der einzige Essay, den Fichte über einen zeitgenössischen
deutschen Schriftsteller schrieb. Was hat es mit dem Titel Ein
neuer Martial auf sich?
AA: Ich kleiner Wicht fühlte und fühle mich noch immer
geschmeichelt, seitdem bin ich ein richtiger Flügelwicht,
ein Geistchen, ein Windwichtel. Also, es gab eine Redakteurin
aus der Reich-Ranicki-Schule, die einen Gedichtband von mir rezensierte
und mir bescheinigte, ich sei kein neuer Martial. Worauf ich
mit einem kleinen einfachen Epigramm entgegnete: »Kein
neuer Martial / sei ich, schreibst du / in deinem Feuilleton. /
Kennst du den alten?«
GS: Du kokettiertst bis heute damit, daß du seinerzeit
den alten Martial selbst nicht gekannt hast.
AA: Stimmt. Durch Invektiven wird man herausgefordert, der Sache
selbst nachzugehen. Im Grunde bin ich Martial nicht ähnlich,
außer in der der Aggressivität und Gegenständlichkeit.
Wir haben gemeinsam, was vor dem Literarischen liegt, Verlangen
und Wut. Ich schulde dem Wiener Franz Schuh die Erkenntnis, daß
das Epigramm gar nicht so sehr auf Leser vertraut, sondern vielmehr
dazu da ist, einen Keil zwischen Machthaber und Gefolgsleute
zu treiben. Es ist dann eine andere Sache, daß Martial
gleichfalls ein Panegyriker war und sich als Lobredner bei seinen
Förderern einschmeichelte. Man sagt, »parcere personis
– dicere de vitiis«, also die Laster benennen, aber
die Personen verschweigen. Er wußte genau, warum er die
Personen verschwieg. Die Kaiser waren seine Gönner.
GS: Gerade die Kaiser waren Martials Problem. Die große
römische Literatur ist von drei Namen bestimmt, Horaz, Ovid,
Vergil. Die hatten den Vorteil, daß sie zur Zeit von Augustus
lebten, der sehr, sehr lange regierte; und einen umtriebigen
Propagandaminister beschäftigen konnte, Maecenas, von dem
sich unser Wort »Mäzen« herleitet. Man konnte
unter Augustus seine Einschleimversuche planen. Zu Martials Zeiten
war diese Sicherheit nicht mehr gegeben, die Kaiser wechselten
fast täglich. Hatte Martial ein Buch fertiggestellt und
es beim Kopisten abgegeben, mußte er sich Gedanken um die
Widmung machen.
AA: Das Schreiben, das Geschriebene konnte lebensgefährlich
werden. Martial mußte bei der Abgabe seines Buchs, seiner
Huldigung damit rechnen, auf den nachfolgenden Kaiser zu treffen,
der seinen Vorgänger erst kürzlich gestürzt hatte,
ihn umgebracht hatte. Ich kam in einer öffentlich-rechtlichen
Anstalt nie in Versuchung, jemanden zu loben; es fiel mir leider
nie jemand ein.
GS: Fichte hat dich mehrmals geehrt. Schon 1976 nahm er von dir
sechs unveröffentlichte Epigramme in sein Lesebuch
auf; es handelte sich dabei um eine Buchreihe, in der ausgewählte
Schriftsteller ihre persönliche Anthologie erstellen durften.
Dem Lesebuch ist außerdem ein Text Fichtes vorangestellt,
Elf Übertreibungen, sehr polemisch. Geschimpft wird
beispielsweise auf die Luther-Bibel, die er anscheinend erst
Jahre später studiert hat.
AA: Es schimpft sich leichter über etwas, was man nicht
kennt.
GS: Es zeigt sich außerdem, daß Fichte einen Widerwillen
hegt gegen alles, was nicht stilisiert und bearbeitet ist. Ein
typischer Satz lautet: »Die Geschichte der Deutschen Literatur
ist die Geschichte des unvorsichtigen Sprachgebrauchs.«
AA: Sehr überheblich.
GS: Und dann gibt es noch eine Charakterisierung: »So schwul
Martials, so martialisch Astels Distichen.« Wenn man dir
folgt, stimmt das nicht.
AA: Sei vorsichtig. Man sollte »martialisch« vielleicht
nicht auf Martial beziehen, es könnte auch der Kriegsgott
Mars gemeint sein. Von diesem leitete sich schon der Name des
Martial selbst ab. Ich galt damals, 1976, als aggressiver Schriftsteller.
Hätte man die Bücher aufmerksamer gelesen, hätte
man gemerkt, daß ich eigentlich ein Softie war.
GS: Na, du warst der Stichwortgeber der APO und der Marschierer
durch die Institutionen … Doch jetzt bitte eine kleine
Unterweisung zu Martial.
AA: Keine »scattered lines«; es sind fünfzehn
Bücher erhalten. Epigramme gemäß der alten Definition,
Aufschriften, auf Gegenstände oder zu Gegenständen
oder zu Ereignissen; auf Personen und auf Verhältnisse.
Es handelt sich sehr oft um Begleitgedichte zu Geschenken, jemand
verschenkt einen geschlachteten Hasen und schreibt dazu vier
Zeilen, zwei Distichen.
GS: Es war witzig, als ich beim Lesen auf solch ein Gedicht als
Beigabe traf. Das Gedicht bezog sich auf eine Ohrensonde. Wem
es im Ohr juckte, der konnte eine Ohrensonde kaufen, mitsamt
Martial-Epigramm.
AA: Man kann sich das nicht trivial genug vorstellen; aber eigentlich
ist es nicht trivial, sondern gegenständlich.
GS: Es gab außerdem die Möglichkeit, Epigramme lediglich
als Klebebilder zu kaufen.
AA: Vor der großen Literatur gibt es die kleine Literatur,
die leider nicht angemessen gewürdigt wird. Auf ein Geschenk
folgen zwei Distichen, eine besondere Art von Höflichkeit.
Ein ganzes Buch, es können sogar zwei Bücher sein,
handelt bei Martial von diesen Sachen.
GS: Xenia und Apophoreta, ergänze ich als
Besserwisser. Und dann gibt es zwölf Bücher mit Epigrammen
in unserem modernen Verständnis. Martial wollte, nach eigener
Aussage, bewußt nicht kunstvoll dichten und schrieb deshalb
Epigramme; die nicht immer kurz sind. Er schrieb epigrammatisch
gegen das Epische an.
AA: Das Epigramm ist eine Kurzform der Elegie; der Wechsel von Hexameter und Pentameter ist das elegische Versmaß. Als Aufschrift hält das Epigramm eine Sache, einen Sachverhalt fest, bewahrt dadurch die Erinnerung daran. Wenn beispielsweise irgendein Kaiser auf die unglaubliche Idee kam, im Amphitheater eine Seeschlacht stattfinden zu lassen.
GS: Du sprichst jetzt das Buch der Schauspiele an, das
der eigentlichen Epigrammsammlung vorangeht, De spectaculis
liber. Wahrscheinlich das grausamste Stück Literatur,
das uns von den Klassikern überliefert wurde. Es geht nicht
nur um die Schilderung von Seeschlachten, sondern um mehr, »quidquid
fama canit, praestat arena tibi«. Die Arena stellt das
vor Augen, was einst gesungen wurde in den alten Gesängen.
Mythen werden neu inszeniert, dargestellt wird etwa, wie ein
Stier Pasiphaë bespringt.
AA: Ich kann mir vorstellen, daß das Volk dabei grölt.
GS: Das Buch der Schauspiele sollte man keinem Verantwortlichen
des Privatfernsehens zeigen.
AA: Mittlerweile auch keinem Unterhaltungschef bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Bereits Martial hat solche Aufführungen nicht kritisiert,
er hat sie gelobt, weil der dem Kaiser schmeicheln wollte. Das
Volk rebellierte erst, wenn an den schattenspendenden Sonnensegeln
gespart wurde, man wollte beim Zuschauen nicht in der prallen
Sonne sitzen.
GS: Im Astel-Martial-Essay bezieht sich Fichte auf griechische
Ausdrücke, die überraschend wirken. So spricht er davon,
daß deine Epigramme eher durch Logopoeia wirken als durch
Phanopoeia. Diese Begriffe traten schon in den Elf Übertreibungen
auf. Als »Kriterien der Sprache und des Denkens«
wurden hier Logopoeia, Phanopoeia und Melopoeia gefordert, sonst
seien Sprache und Denken selbst gefährdet, »und damit
menschliche und menschenwürdige Existenz«.
AA: Hm, ich versuche jetzt, mir selbst ein Bild von den Begriffen
zu machen. Logopoeia wäre sozusagen das Dialektische, das
Gedankliche, das zu Worten führt. Phanopoeia wäre die
Faszination durch die Phänomene, die Erscheinungen. Das
ist mein Verständnis, ich gebrauche diese Begriffe nicht.
Und Melopoeia wäre dann der Wohllaut, der in der Dichtung
eine große Rolle spielt. Die Poesie leistet keine Überzeugung,
sie verführt, sie betreibt Verlockungen durch die Melodie,
die Sprachmelodie. Unter philosophischem Gesichtspunkt ist ein
solches Vorgehen sehr fragwürdig, deshalb wollte Plato die
Dichter aus dem Staat vertreiben. Dichtung ist eine Verführungskunst;
es gelingt, das, was ungereimt ist, zu reimen. Der Reim kommt
auch in der Antike vor, nicht als Endreim, sondern als Binnenreim.
Und der Binnenreim hängt mit der Melodie zusammen und der
Singbarkeit, der Wiederholung der Laute, dem Wohllaut in der
Lautfolge. Dichterisch verführt man zu einem Gedanken. Es
ist eine läppische Nettigkeit, davon auszugehen, daß
das Denken selbst zur Erkenntnis führe. Gefragt ist die
Verlockung, der verlockende Gedanke. Oder anders ausgedrückt
das Mitreißende des Irrtums. Der mitreißende Irrtum
der Vorsokratiker – das ist Poesie. Wenn heute Poesie irgend
etwas taugt, dann kommt sie den Vorsokratikern nahe. Durch Verlockungskraft,
Verführungskraft, durch Melodie und Sprachklang, und durch
Wortsetzung; durch die Zeile, die wohlgesetzte Zeile.
GS: Aha. Fichte hätte bei deiner Konfession andauernd genickt,
er hat sich selbst als Vorsokratiker verstanden.
AA: Auch die Ethnologie ist eigentlich vorsokratisch, sie forscht
den Irrtümern der Aborigines nach. Und dies sind Irrtümer
lediglich unter dem Aspekt der Aufklärung. Aber Irrtümer
haben mit menschlichem Denken mehr zu tun als die Aufklärung,
wichtig war die Aufklärung als Aggression gegen Klerus und
Aristokratie.
GS: Die Vorsokratiker wirken bis heute wegen der genannten Kriterien
Logopoeia, Phanopoeia und Melopoeia. Fichte hat sie Ezra Pound
entlehnt, man sollte einmal selbst nachschlagen.
AA: Pound ist nicht nur der Verfasser der Cantos, über
deren Gelingen man verschiedener Meinung sein kann; weil es überhaupt
nicht gelingen kann. Er hat außerdem wunderbare, wundersame
kleine Gedichte geschrieben, In a Station of the Metro:
»The apparition of these faces in the crowd: / Petals
on a wet, black bough.« Großartig.
GS: Ein beeindruckendes Beispiel für das, was Pound unter
Phanopoeia versteht; ein Wahrnehmungsbild noch einmal hervorzurufen
in der Literatur.
AA: Ein Bild, eine Erscheinung festhalten – das ist eine
Epiphanie. Poesie hat mit Phänomenen zu tun, sie nimmt wahr
mit den Sinnen.
GS: Noch einmal zurück zu den Anmerkungen Fichtes. Es wird
dir zugestanden, sehr belesen zu sein.
AA: Eigentlich bin ich nicht belesen. Ich bin kein Gelehrter,
aber ich habe das Verlangen nach Wissen. Und deshalb greife ich
zu anderen Büchern, wobei sich seinerzeit Huberts und meine
Lesepfade gelegentlich kreuzten.
GS: Besonders angetan ist Fichte davon, daß du die Anthologia
Graeca strukturieren kannst.
AA: Dazu kann ich etwas sagen. Ich habe sie für mich selbst
strukturiert, mühsam auf Karteikarten den Inhalt der einzelnen
Bücher notiert. Man kann das, wenn man sie gelesen hat.
Ich habe mich also sozusagen strukturalistisch damit beschäftigt.
Und als ich erfahren habe, daß Hubert sich mit der Anthologia
Graeca abmüht, habe ich ihm freundlicherweise eine Kopie
geschickt. Mehr war nicht.
GS: So sterben Mythen der Rezeption.
AA: So sind die Mythen selbst.
GS: Würdest du Fichtes Aussage zustimmen, daß alle
deine Epigramme Gedankenlyrik seien, »viel Logopoeia –
wenig Phanopoeia«? Fichte schrieb immer »Phaenopoeia«.
AA: Gedankenlyrik, hm; stimmt Gott sei Dank nicht. Hubert bezog
sich größtenteils auf das dicke Buch bei Zweitausendeins,
Neues (& altes) vom Rechtsstaat & von mir.
Es war damals eine gelenkte Rezeption; von mir, ein wenig opportunistisch,
politisch gelenkt. Politische Gedichte sind normalerweise keine
Erscheinungsgedichte. Dazu ließe sich noch einiges sagen.
GS: Ab und zu widerspricht sich Fichte bei seinen Astel-Diagnosen;
du bist eben ein vielseitiger Schriftsteller. Unerwähnt
soll jedoch nicht bleiben, daß du, folgt man Fichte, »verheerend«
den »Neuen Menschen« singst, »den Medienmenschen«;
das hat er bereits 1983 geschrieben.
AA: Viele meiner dialektischen Gedichte beziehen sich auf die
Medien, ich war ja Literaturredakteur.
GS: Es gebe dann außerdem »alternative Epigramme
und erotische«, »verkrampfter beide als beim Schmeichler
aus Rom«.
AA: Ich bin bis heute der Meinung, daß ich und meine Gedichte
nicht verkrampft sind.
GS: Hierzu wäre eine merkwürdige Tatsache nachzutragen.
Der Essay wurde seinerzeit von Fichte im Sender Freies Berlin
vorgelesen, wobei einige Stellen weggekürzt worden waren,
die sogenannten obszönen Passagen; beispielsweise Martials
und Astels Entsprechungen in der Skatologie, wie Fichte es nennt.
Diese Stellen, die im Originalmanuskript stehen, fehlen in der
Werkausgabe der Geschichte der Empfindlichkeit, im entsprechenden
Essay-Band.
AA: Das ist eine große Schande; bedauerlich vielleicht
nur wegen der fehlenden Epigramme Martials.
GS: Fichte betont vor allem dein Geschick, in Epigrammen eine
»Geologie der Moderne« zu entwerfen. Und er hätte
im Vorabdruck Verweilen der Wellen auf dem Pflasterstein
von 1981 Phanopoeia am Werk sehen können.
AA: Die Phänomene interessieren mich bis heute viel mehr
als die Literatur. Die Literatur interessiert mich, wenn sie
neben den Phänomenen bestehen kann. Wenn sie wahrgenommen
werden kann wie ein Gegenstand, wenn sie eine lapidare Inkarnation
ist.
GS: Zu Beginn erwähnt Fichte deine prägende Zeit, die
Zeit in Heidelberg; ein bemerkenswerter Ort, ein literarischer
Ort.
AA: Ich bin von der Landschaft beeinflußt; und von einem
Freund, einem Lehrer, meinem Lehrer Andreas Rasp.
GS: Der einen berühmten Vater hat.
AA: Nämlich Fritz Rasp.
GS: Den Hauptdarsteller in Fritz Langs Metropolis.
AA: Von Andreas Rasp erfuhr ich schon in den fünfziger Jahren,
wer Hopkins und Kavafis waren. Wir trafen uns einmal in der Woche,
um über Gedichte zu sprechen. Das waren Sternstunden. Damals
habe ich meine Empfindlichkeit für Literatur ausgebildet,
damals war ich brillant. Und begann damit, die Lyrischen Hefte
herauszugeben.
GS: Als Heidelberg-Neophyt wirst du später Autor eines Verlages,
der in seinem Namen anspielt auf ein großes Buch der Deutschen.
AA: Auf eine Sammlung Achim von Arnims und Clemens Brentanos.
Mit dem Titel Des Knaben Wunderhorn, der dem Wunderhorn
Verlag seinen Namen gab.
GS: Man wollte einmal die blaue Blume der Romantik rot färben,
das hat sich geändert … Ich war übrigens
einmal dabei, als Michael Buselmeier behauptete, das beste Buch
bei Wunderhorn sei noch immer der Sperber von Maheux,
ein ethnographischer Roman Jean Carrières über den
Untergang bäuerlicher Lebensformen in den Cevennen; Carrière
ist ein Schüler Jean Gionos. Lothar Baier schrieb vor einigen
Jahren, Carrière erinnere sich, daß, als er Sekretär
bei Giono gewesen sei, ein junger Deutscher im Nachbardorf Montjustin
die Schafe gehütet habe. Und dieser junge Deutsche habe
Hubert Fichte geheißen.
AA: Hubert kannte das, was vor der Literatur liegt. Aber er hat
die Schafe in der Provence gehütet, dem Stammland der Troubadour-Dichtung,
auf welche Pound immer wieder hingewiesen hat.
GS: Fichte kommt im Essay über dich auf deine Lyrischen
Hefte zu sprechen; er lobt vor allem deine Edition von Quirinius
Kuhlmann.
AA: Das war ein Sonderheft, die Himmlichen Libes-Küsse.
Das erste Gedicht im ersten Heft stammte von Karlheinz Stierle,
den wir alle nur Kay nannten. Er wurde dann ein großer
Romanist, veröffentlichte vor kurzem ein dickes Buch über
Petrarca. Andere Namen wären Bobrowski, Brinkmann, Brodskij,
Genazino und so weiter.
GS: Und Wolf Wondratschek, der Jahre später sein Lesebuch,
seine persönliche Anthologie, einem gewissen Wolli Köhler
widmen sollte. Bei unseren Vorbereitungen haben wir ebenfalls
festgestellt, daß im zweiten Heft ein weiterer Fichte-Satellit
auftaucht, nämlich Rainer Fabian. Der Mann ist kürzlich
wieder ins Gespräch gekommen; er veröffentlichte im
letzten Jahr einen Roman, Das Rauschen der Welt, es geht
um einen Reporter in Lateinamerika, es ist ein Krimi. Und dieser
Rainer Fabian hat 1967, vor Palette und Detlevs Imitationen
»Grünspan«, einen lesenswerten Aufsatz geschrieben,
innerhalb einer Zeitungsserie über »Künstler
in der Werkstatt«, Hubert Fichte – der Vivisekteur.
Dem Artikel sind zwei Fotos von Leonore Mau beigegeben. Man sieht
das, so heißt es wörtlich, »Sprach-Labor«,
Fichtes Arbeitszimmer mit den berühmt-berüchtigten
an die Wand genagelten Manuskriptseiten, und das sogenannte »Milieu«,
Fichte scheint sich auf Wolfgang Köhlers Pfaden herumzutreiben.
Fabian berichtet weiter, daß auf dem Schreibtisch ein Band
mit Translations of Ezra Pound liege, ferner ein Sachwörterbuch
der Literatur und das erste Blatt eines neuen Romans, des späteren
Romans Detlevs Imitationen »Grünspan«.
Fichte denke daran, bei der Beschreibung der Bombenangriffe auf
Hamburg die Wörter selbst zu zerstören. Im Rückblick
beeindruckt die Einschätzung Fabians, »Fichtes Werkstatt«
sei das Labor in seinem Kopf.
AA: Ergebnisse dieses Labors ließ ich Hubert dann im Saarländischen
Rundfunk lesen, eben Detlevs Imitationen »Grünspan«,
bevor der Roman überhaupt erschienen war … Noch
kurz zu Ezra Pound. Die Idee des Ideogramms, beispielsweise bei
Schilderung der Bombenangriffe die Wörter selbst zu zerstören,
hatte Hubert, wie es jetzt deutlich wird, direkt von Pound übernommen.
GS: Zwanzig Jahre nach Fabians Werkstattbericht ist Fichte leider
schon tot. Bei dir ist mir ein Foto aufgefallen; es zeigt den
Grabstein Fichtes mit einer griechischen Inschrift, mit einem
Epigramm.
AA: Das auch in der Anthologia Graeca steht, es ist von Empedokles und bezieht sich auf die Wiedergeburt. Leonore Mau hat mir ein Foto des Grabsteins geschickt, auf dem das Originalzitat steht, ohne Übersetzung und Quellenangabe. Leonore Mau teilte mir mit, daß Hubert Fichte dieses Epigramm in Brasilien auf den Meeresstrand geschrieben hatte, auf den feuchten Teil des Strandes, wo die Wellen auslaufen; er schrieb mit dem Finger. Damals schon hatte ich mich an einer Übersetzung versucht. Und anläßlich unseres Gesprächs habe ich ein kleines Erinnerungsgedicht verfaßt, Epitaph Hubert Fichte,
wobei ich Empedokles mit einem Finger schreiben lasse und zusätzlich
die Grabschrift ins Spiel bringe: »Wellengebirge /
zeichnet und löscht / die Brandung. Am Strand /
von Akragas schreibt / Empedokles in den Sand: / Als
Mädchen – er schreibt mit dem Finger – /
als Fichte und Mann. / Einmal schon / war ich geboren, /
Zweig und Vogel und Fisch, / der heiß aus den Wassern /
emporschnellt.« – Das für Hubert Eigentümliche,
weshalb es auch auf dem Grabstein steht, sind die Worte »korê
kai kouros«, Mädchen und Mann; der Gedanke der Wiedergeburt.
Er trägt all das in sich und gebiert es aus sich wieder,
ideell, in seinen Gedanken und Worten; oder er läßt
sich gebären. Der Gedanke der Wiedergeburt ist in Wirklichkeit
auch die Vorstellung von der Auferstehung alter Gedanken von
Leuten, die nicht mehr leben. Aber sie sind durch ihre Fußspuren
und Fingerspuren zu uns gekommen. Die Auferstehung, auch die
Literatur, findet in unserem Kopf statt, in unseren Gedanken,
in unseren Vorstellungen. Und die Literatur hilft uns dadurch,
unsere eigenen Wahrnehmungen zu vergleichen mit dem Vorbild der
Menschen, die vor uns gelebt haben.
GS: Jemand, auf den Fichte schlecht zu sprechen war, nämlich
Canetti, sah in Schriftstellern die Hüter der Verwandlungen.
AA: Ich gehe noch weiter. Dichter sind die Hüter einer menschlichen
Utopie.
GS: Der Inbegriff dieser Utopie ist merkwürdigerweise Fichtes
Grabschrift. Er zieht sich durch das ganze Spätwerk. Besonders
eindrucksvoll im Forschungsbericht, der in Mittelamerika
spielt, wo bereits Olson anthropologische Studien betrieben,
frühen menschlichen Spuren nachgeforscht hat. Es fallen
auch die Namen von Pierre Verger und Lydia Cabrera, Herodot als
erster Ethnograph ist nicht zu vergessen. Aber eigentlich kreist
der Roman um eine genaue Übersetzung des Empedokles-Epigramms:
»Schon irgendeinmal nämlich war ich Knabe und Mädchen
und Baum und Raubvogel und auch aus Salzwasser«; oder so
ähnlich. Übersetzend wird eine Entwicklungsgeschichte
des Menschen entworfen.
AA: Empedokles war ein Vorsokratiker, es ist einiges von ihm
überliefert.
GS: Er hat zwei größere, epische Dichtungen verfaßt,
Über die Natur. Und die Reinigungen, was griechisch
»katharmoi« heißt, sehr eng verwandt mit Katharsis.
Die Reinigungen beschreiben den Weg eines Ich nach dem
Sündenfall, nach dem Verlust von Gnade und Grazie. Es findet
durch rituelle Praktiken zurück in einen Zustand der Unschuld,
zu einer reinen Religion, wobei es einen Inkarnationszyklus durchlaufen
muß. Bemerkenswert ist, daß man sich die einzelnen
Metamorphosen materiell, materialistisch vorzustellen hat.
AA: Na; alle Wiedergeburten sind irdische Wiedergeburten. Anders
ließe es sich nicht verstehen, nicht sehen. Auch wenn man
sich, wie Empedokles, in den Ätna stürzt. Die Erinnerung
sichern dann die Dichter, von Hölderlin bis Brecht.
GS: Die Grabinschrift ist eine Zumutung. Bis über den Tod
hinaus bleibt Hubert Fichte klassisch-antik ausgerichtet. Gegen
Lebensende hat er sich wahrscheinlich als Philologe der Alten
verstanden, er liebte die Sprache von Archilochos, Sappho und
Empedokles. Ich will ein wenig provozieren: Fichtes Klassiker-Interpretationen
kommen mir stellenweise ausgesprochen imperialistisch vor.
AA: Nein, das ist mir zu gewaltig. Es handelt sich um Aneignungsversuche,
gelegentlich überheblich, snobistisch. Hubert wollte sich
absondern von einer Banalität, die ihn geärgert, ihn
angewidert hat. Es war durchaus eine Flucht ins Elitäre
von jemandem, der einen festen Punkt im Leben finden wollte,
indem er einen festen Punkt in der Literatur suchte. Ungebildet
fing er an als Schäfer in der Provence.
GS: Fichte begann, im Wortsinn, idyllisch, bukolisch.
AA: Ja, vorliterarisch. Vielleicht wurde er am Lebensende ein
wenig dünkelhaft. Er war nicht imperialistisch, aber er
zog einen Grenzstrich zwischen sich und jene Bildungsbürger,
die sich imperial der Antike näherten. Er verachtete die
humanistischen Steißtrommler, die verblödeten Einpauker.
GS: Der Abschlußband von Fichtes Geschichte der Empfindlichkeit
trägt den Titel Hamburg Hauptbahnhof. Register. Er
enthält ein langes Interview mit Wolli und Linda von 1982,
es ist ein Band über die Wechseljahre des Mannes, eine Exkursion
in Zeiten von AIDS und Disketten, in Zeiten von Viren, während
die Welt als Buch zu Ende geht. In kurzen Kapiteln wird die Entstehung
von Gespenstern beschrieben, von Monstren, die als quälende
Nachbilder das ganze Leben bestimmen. Die »Schwierigkeit
der familiären Angelegenheit Jäckis« bestehe
darin, »daß er in einer Generation, in einer Person
den Hauptteil der Sagen des klassischen Altertums« durchspielen
wolle.
AA: Es ist die Antwort eines Machtlosen. Hubert nutzte die Antike
als Bündnispartner, auch gegen den Literaturbetrieb.
GS: Wobei Fichte gegen Ende von seinem anfänglichen Charme
verlor, wenn er verbissen die Klassiker zu eng interpretierte,
zu einseitig.
AA: Das ist sein gutes Recht. Und wenn ich mich an die letzten
Telefongespräche erinnere, habe ich ihn in sehr guter Erinnerung,
er war witzig, ab und an sarkastisch. Er war ein Verzweifelter,
ein Sterbender. Seine Provokationen können doch den Wusch
auslösen, selbst nachzuschlagen, die Alten selbst zu lesen.
GS: Selber mehr zu wollen.
AA: Ja. Hubert konnte neugierig machen. Der Sog dessen, was man
nicht verstanden hat, das Unverstandene, Unbeschreibliche, Unveröffentlichte,
übt eine Faszination aus.
GS: Es gibt nicht nur das Leben und die Literatur, es existiert
außerdem eine exquisite Dialektik. Nicht nur die Literatur
kann auf das Leben zurückschlagen, sondern auch das Leben
kann auf die Literatur zurückschlagen, kann sich in Literatur
niederschlagen. 1985, im März, erschien eine Sondernummer
des Schreibhefts zu Fichtes fünfzigstem Geburtstag,
mit dem besagten Aufsatz von dir über Archilochos. Genau
zu dieser Zeit ist dir etwas zugestoßen.
AA: Ja. Mein Sohn Hans hat sich im März 85 umgebracht.
GS: Wo hast du dich, als die Nachricht eintraf, zum ersten Mal
aufgehalten?
AA: Peinlicherweise in Delphi.
GS: Delphi ist die Kultstätte des Apollo, des Schutzgottes
von Archilochos.
AA: Apollo konnte nicht nur die Harfe spielen, er war auch ein
treffsicherer Todesschütze. Apollo als Todesgott ist eine
interessante Sache. Der materiale Transfer hängt mit dem
Bogen und der Lyra zusammen; und mit dem Laut, den die Spannung,
das Gespannte von sich gibt. Tod und Musik haben bei Apollo den
gleichen Ursprung, es geht bei ihm um die Treffsicherheit von
Pfeil und Gesang. Wie bei der Jagd, »à la chasse«.
Literatur ist kein harmloses Spiel, wenn man sie ernst nimmt.
GS: Seit 1985 betrauerst du in Epigrammen den Tod deines Sohnes;
du hast sogar, als Erinnerung, seinen Vornamen in deinen Namen
aufgenommen, Hans Arnfrid Astel. Es gibt noch einen prägenden
Menschen.
AA: Meinen Vater, der sich ebenfalls umbrachte. Er hat sich 1945
erschossen, als die Front schon sehr nahe stand. Er war ein sogenannter
Rassehygieniker, Professor der Vererbungslehre, Freund der Enkel
Ernst Haeckels, Rektor der Universität Jena. Das ist natürlich
mein lebenslanges Trauma. Ich sehe in seinem Leben und Tod eine
ungeheure Tragödie. Als Sohn habe ich zuerst Biologie studiert,
und dann Literatur. Das war meine Art der Trauer, es war keine
Abrechnung.
GS: Wer hat 1945 den Leichnam deines Vaters in Jena identifiziert?
AA: Sein Nachfolger als Rektor, Max Bense.
GS: In Detlevs Imitationen »Grünspan«
gibt es am Ende einen Abgesang auf alle Hoffnungen der sechziger
Jahre. Alles wird verabschiedet, sogar das klassische Griechenland,
es ist das Griechenland-Bild Goethes, einzig Marcel Proust bleibt
ausgenommen. Und ein zukünftiges Unternehmen, nämlich
die Suche nach einer Theorie der Empfindsamkeit; damals hieß
es noch Empfindsamkeit, nicht Empfindlichkeit. Die Ernüchterung
findet ihren Höhepunkt in einer doppelten Verneinung, »Keine
›Keine Anrufung des großen Bären‹ mehr«.
Angespielt wird nicht – oder nicht nur – auf Ingeborg
Bachmanns Gedichtband Anrufung des großen Bären,
sondern auf den Text Teile von Max Bense. 1960 veröffentlichte
Paul Wunderlich Lithographien über die Schrecken des Dritten
Reiches mit dem Titel 20. Juli 1944. Benses Einführung
fing mit den Worten »Keine Anrufung des großen Bären«
an und schloß mit der Erkenntnis, »wenn der Mensch
zerstört wird, kehrt erst mit der Verwesung das Menschliche
zurück«. Bense selbst versuchte, Gefahren mythischen
Denkens dadurch zu bannen, daß er in der Antimetaphysik
der Informationstheorie seine Zuflucht suchte. Und als Fichte
Benses Verneinung noch einmal steigerte, gab er schon 1969, in
Detlevs Imitationen »Grünspan«, seine
kommende Entwicklung preis. Es wird um die Reinigung von Körper
und Seele gehen; Fichte hätte später griechische Wörter
vorgezogen. Soma, Psyche, Katharsis.
AA: Wir haben über Elementares geredet, auch über Tragödien in meinem Leben. Ich will eigenmächtig unser Gespräch mit einem Epigramm beschließen; es steht auf dem Grab meines Sohnes Hans: »Mit silbernem Pfeil / hat dich Apoll erschossen. / Nun klagt er sein Leid / der schwarzen Drossel.« – In Delphi gibt es einen Teller, auf dem Apollo einer Krähe ein Trankopfer darbringt. Die Krähe ist die Metamorphose seiner ehemaligen Geliebten, sie hat sich in eine Krähe verwandelt, nachdem der Gott sie aus Eifersucht getötet hat. Klein ist sie als mahnende Erinnerung auf dem Teller zu sehen. Man kann jetzt vielleicht das Epigramm noch einmal lesen.
GS: Vielleicht nicht nur das Epigramm.